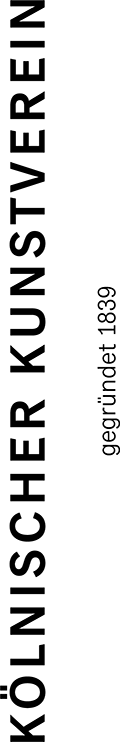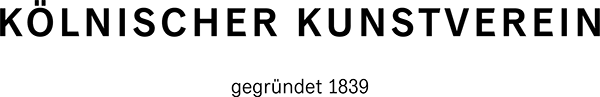Die Ausstellung Keine Donau führt drei künstlerische Positionen zusammen und stellt sie zueinander in Beziehung. Cameron Jamie und Peter Kogler haben für den Kölnischen Kunstverein Filme des 1998 verstorbenen Undergroundfilmers Kurt Kren in die gemeinsam entwickelte Ausstellung eingebunden, in deren formalem Mittelpunkt die Wechselbeziehung zwischen Kunst, Film und Architektur steht. Experimentelle Filme von Kurt Kren, der zu den wichtigsten Vertretern der internationalen Filmavantgarde zählt und als einer der Wegbereiter des strukturellen Films gilt, stehen dabei im Dialog mit neuesten raumbezogenen Arbeiten von Peter Kogler und mit Arbeiten des amerikanischen Künstlers Cameron Jamie.
Der Ausstellungstitel ist einem Film von Kurt Kren entliehen. Die radikale Auseinandersetzung mit dem Medium Film und die genaue Analyse von Wahrnehmung sind charakteristisch für das filmische Werk Kurt Krens. Kurt Kren hat aus den grundlegenden Faktoren des reinen Kinos – Bewegung, Material, Licht und Wahrnehmung – seine Filme entwickelt und dabei nicht nur mit Licht und Wahrnehmung, sondern auch mit den Apparaturen des Filmemachens experimentiert. Extrem schnelle Schnitte, die auf Partituren mit seriellem, strukturellem und mathematischem Charakter beruhen, Mehrfachbelichtungen, Unschärfen, Behandlungen der Tonspur durch Kratzung und Zeichnung bestimmen die vibrierende und dynamische Bildsprache Kurt Krens, die eine neue Form des Bildes und der Wahrnehmung entstehen lässt.
Die von Peter Kogler für den großen Ausstellungsraum des Kunstvereins konzipierte Videoinstallation stellt Verbindungen zwischen einem der zentralsten strukturellen Filme Kurt Krens, „48 Köpfe aus dem Szondi-Test“, und einer eigenen, neuen Arbeit sowie mit Cameron Jamies Studien für den Film „Spook House“ her. Peter Kogler hat bereits früh, zu Beginn der 80er Jahre mit den damals aufkommenden Computertechnologien experimentiert und nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht. Ausgehend von den konzeptuellen Erfahrungen der Pop-Art im Umgang mit Massenmedien, mit der Idee des Seriellen und mit den neuen Reproduktions-Technologien entwickelte er seit Anfang der 90er Jahre „virtuelle“ Bildwelten, die Körper und Räume überspielen und in denen die Grenzen von Bild, Skulptur, Architektur und Medien aufgehoben scheinen. Seine Transformierungen von raumgreifenden Zeichen und Bildern verweisen auf eine vollkommene Durchdringung des öffentlichen und privaten Raumes mit diesen Zeichen und auf eine damit einhergehende Verschmelzung dieser Bereiche.
Die Arbeiten Cameron Jamies sind vom Phänomen Fantasy und von Beobachtungen und Erfahrungen subkultureller Repräsentationsformen in urbanen, amerikanischen Vorstädten wie auch in europäischen Alltagskulturen geprägt. Amerikanische Backyard Wrestler, ‚spook houses’ und andere unheimlich anmutende theatralische Inszenierungen, die mit Tod, Verdrängung, Angst und Gewalt zu tun haben, sind nur einige Rituale einer Alltagskultur, die Cameron Jamie mit seiner Kunst erforscht. Sein Blick gilt den Auswirkungen dieser rituellen Praktiken auf die Psyche und das Alltagsleben, ebenso wie der ihnen immanenten Phantasie und Poesie.
Die Ausstellung Keine Donau zeigt neben filmischen Arbeiten auch Zeichnungen, Skizzen, Kaderpläne, Objekte, sowie eine Skulptur, die Cameron Jamie gemeinsam mit dem österreichischen Schnitzer Max Kössler für die Ausstellung produziert hat. In die Ausstellung miteinbezogen ist auch eine Auswahl von aktionistischen Filmen Kurt Krens, die in Zusammenarbeit mit seinen Künstlerkollegen Otto Mühl und Günter Brus entstanden sind. Im Zusammenspiel der verschiedenen künstlerischen Positionen ist eine Ausstellung entstanden, die von Überschreitungen und Ausdehnungen von Grenzen handelt. Die Ausstellung reflektiert ein Unheimliches und ein Abgründiges unserer Gesellschaft, dessen Repräsentationen im Alltäglichen irritierende und angstbesetzte Dimensionen entwickeln können. Auch die Nachtversion der Ausstellung setzt die Grenzen des Innen- und Aussenraums scheinbar ausser Kraft, wenn die Fensterfront des großen Ausstellungsraumes sich zur Straße hin „öffnet“ und die Arbeiten von Cameron Jamie, Peter Kogler und Kurt Kren in die Stadt hinausstrahlen: Referenz auch an die große Kinotradition des Kunstvereinsgebäudes.
Cameron Jamie, geboren 1969 in Los Angeles, lebt und arbeitet in Paris.
Ausstellungen (Auswahl): Whitney Biennale, New York (2006); MUKA, Antwerp (2005); Walker Art Center, Minneapolis (2006); Venice Biennale (2005); Bernier/Eliades Gallery, Athens (2005); Magasin/Musée Gó-Charles, Grenoble (2004); Artangel London (2003); The Wrong Gallery, New York (2003); Galerie Christine König, Vienna (2003); Centre Georges Pompidou, Paris (2002); Rotterdam International Film Festival (2001); Stedelijk Museum, Ghent (2001).
Peter Kogler, geboren 1959 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien.
Ausstellungen (Auswahl): Museum of Modern Art, New York (2006); Casino Luxemburg, Luxembourg (2005); Galerie Mezzanin, Vienna (2005); Museum für angewandte Kunst, Vienna (2004); Galerie im Taxispalais, Innsbruck (2004); Kunstverein Hannover (2004); Galerie Crone, Berlin (2004); Bawag Foundation, Vienna (2003); Venice Biennale (2003); Schauspielhaus Frankfurt (2002); Villa Arson, Nice (2002); Fondation Beyeler, Basel (2001); Kunsthaus Bregenz (2000); Ars Electronica, Linz (1999); documenta X, Kassel (1997); documenta IX, (1992).
Kurt Kren (1929-1998) war ein avantgardistischer Filmemacher, der in Houston/Texas und Wien gelebt hatte.
Seit der Mitte der 1960er Jahre nahm er an internationalen Filmfestivals teil und war international als einer der wichtigsten Underground-Filmemacher bekannt. Ausstellungen (Auswahl): documenta, Kassel (1977); Kölnischer Kunstverein (1977); Hayward Gallery, London (1979); Retrospective, Museum of Modern Art, New York (1979); Secession, Wien(1996); Atelier Augarten, Wien (2006).