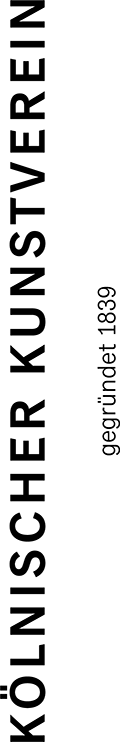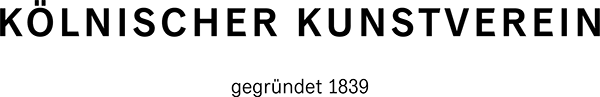Archiv (Auswahl)
-
Einzelausstellung: Chris Korda, 25.5. – 14.7.2024
 Artist's Con(tra)ception
Artist's Con(tra)ception
CHRIS KORDA
Artist’s Con(tra)ception
25.5.–14.7.2024
Eröffnung: Freitag, 24.5., 18–21 Uhr, Ansprache um 19 UhrKreisch! Chris Korda is in the house. Ungeheuerlich, unerträglich, unfassbar gut. Korda wurde 1992 von einem seltsamen Traum heimgesucht, in dem eine außerirdische Intelligenz namens „Das Wesen“ behauptete, in einer anderen Dimension für die Menschen zu sprechen. Es warnte vor dem Zusammenbruch des Ökosystems unseres Planeten. Als Korda aus dem Traum erwachte, sagte sie: „Save the Planet – Kill Yourself“.
Kordas Mission gründet auf der Überzeugung, dass der Mensch, ein egozentrischer Zerstörer, in seine Grenzen gewiesen werden muss. „Danke, dass sie sich nicht fortpflanzen“, lautet die an den guten Willen appellierende Empfehlung. Meine DNA reiche ich nicht weiter, ich steige aus dem Genpool aus. Schluss mit anthropozentrischer Hybris. Wer aus freien Stücken aus dem Leben scheiden möchte, soll das tun dürfen – und leistet nebenbei einen sinnvollen Beitrag. Die Möglichkeit der Abtreibung ist ein Segen. Sex ist wunderbar, solange er nicht der Reproduktion dient. Wer unbedingt Fleisch essen will, nur das der eigenen Gattung – man tötet keine anderen Lebewesen. Die Empfehlungen der 1992 in Boston von Reverend Chris Korda gemeinsam mit Pastor Kim gegründeten Kirche, der Church of Euthanasia, lassen vielen die Haare zu Berge stehen. Allein der Name der Glaubensbewegung führt zur Verkrampfung der Gesichtszüge. Die Empfehlungen zur Dezimierung der Art Homo Sapiens sind extrem, teilweise widersprüchlich und streitbar.
Schönreden muss man den Namen der Kirche nicht, aber im Hintergrund haben, dass die CoE auf Freiwilligkeit, einem anti-autoritären Ethos beruht.
Die CoE rief Korda ins Leben, da eine Kirche, anders als eine politische Partei, in der Lage ist, ethische Normen neu zu gestalten. Einige ihrer Taktiken sind verwandt mit denen der Situationisten und der Dadaisten: Auch Kordas Aktionen treten in offene Situationen, Strategien werden immer wieder überraschend geändert; die Zungen, in denen sie spricht, sind unversöhnlich und Widersprüche zugelassen. Gleichzeitig bleibt ihr provozierendes Tun immer spielerisch.
Was Chris Korda bereits Anfang der 1990er propagierte, weil sie die irreversiblen Entwicklungen menschlicher Umweltzerstörung erkannte, war ihrer Zeit voraus: vegan zu leben, die Grenzen des Wachstums zu respektieren und die Vielfältigkeit aller Arten zu proklamieren.Korda ist aber nicht nur Reverend. Sie ist vieles und in erster Linie aktiv als Musikerin. Sie gilt als eine der eigensinnigsten und schroffsten Positionen des Techno. In Europa erlangte sie Ende der 1990er Jahre erstmals Präsenz durch DJ Hell aus München mit seinem Label International Gigolo Records.
Jetzt hier erhältlich:
Official Church of Euthanasia T-Shirt
ADAGIO FOR COLOR FIELDS Chris Korda, Publikation von Goswell Road, ParisDie Ausstellung wird unterstützt durch:

Mit besonderem Dank an: Anthony Stephinson und Coralie Ruiz von Goswell Road, Paris; Matthias Sohr; Blandine Houtekins, Le Confort Moderne, Poitiers; Alex Sinh Nguyen; Wolfgang Voigt, Veronika Unland; Hans-Christian Dany; Moch Figuren, Köln.

Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installation view Kölnischer Kunstverein, 2024. Photo: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
THANK YOU FOR NOT BREEDING, 1997. Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Sperm Flake Sunburst, 2002. Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Whorld Anemone, 2005. Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Listenting Station, Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Listening Station, Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Chris Korda, Artist’s Con(tra)ception. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. -
Einzelausstellung: Amanda van Hesteren, 13.4. – 5.5.2024
 If All This Was Fiction: Films 2016–2023
If All This Was Fiction: Films 2016–2023
Amanda van Hesteren
If All This Was Fiction: Films 2016–2023Filmprogramm im Kino des Kölnischen Kunstvereins, kuratiert von Nicholas Tammens
Eröffnungsabend: Freitag, 12.4., 18 Uhr
18:30 Uhr Screening Filme
19:30 Uhr Gespräch zwischen Amanda van Hesteren und Nicholas Tammens in englischer Sprache
20:30 Uhr Wiederholung ScreeningAmanda van Hesteren – If All This Was Fiction: Filme 2016–2023 im Kölnischen Kunstverein ist die deutschlandweit erste Präsentation von Filmen der niederländischen Filmemacherin Amanda van Hesteren (geb. 1991, Amsterdam). Das Programm zeigt die Entwicklung von van Hesterens Methodik als Filmemacherin in den letzten acht Jahren anhand von vier Filmporträts, die sich auf Flirts, Familie und Freund:innen konzentrieren.
Amanda van Hesteren fand mit 23 Jahren zum Filmen, als sie eine Kamera in den Urlaub nahm. „Ich nahm meine Kamera mit, weil ich Geschichten finden wollte“, erzählt sie. „Mir war klar, dass ich sie direkt auf der Straße finden würde“. In den acht Jahren, die seither vergangen sind, hat van Hesterens Kamera gleich mehrere Perspektiven eingenommen: ihren eigenen Blick, den ihrer Protagonist:innen und den Blick des Stand-Ins sowie außenstehender Beobachtender.




Das Filmprogramm wird gefördert von:

-
Ausstellung: Kölner Architekturpreis, 9. – 14.4.2024


Kölner Architekturpreis 2024
Di., 9.4. – Sa., 13.4., je 11–18 Uhr
So., 14.4. 11–16 Uhr
Eintritt frei
Weitere Informationen -
Ausstellung: Hoi Köln, 3.2. – 24.3.2024
 Teil 3: Albtraum Malerei
Teil 3: Albtraum Malerei
Eröffnung: Freitag, 2. Februar, 18 Uhr
Marie Angeletti, Monika Baer, BLESS, Vittorio Brodmann, Jakob Buchner, Milena Büsch, Merlin Carpenter, Matthias Groebel, Fischli Weiss, Hansi Fuchs, Sophie Gogl, Hamishi Farah, Jacqueline Humphries, Dozie Kanu, Nora Kapfer, Morag Keil, Emil Michael Klein, Maggie Lee, Lorenza Longhi, Alan Michael, Kaspar Müller, Vera Palme, Gunter Reski, Jean-Frédéric Schnyder, Dennis Scholl, Nolan Simon, Dominik Sittig, Lucie Stahl, Megan Francis Sullivan, Alfred d’Ursel, Amelie von Wulffen, Jie Xu, Barbara Zenner, Damon Zucconi
Vor dieser eckigen Leere könnte alles werden. Der Horizont des Möglichen scheint offen. In jedem Moment wird ein Einfall durch das Bewusstsein zucken und alles auf die Leinwand bringen. Es könnte noch besser kommen, wenn der Pinsel nur anfinge und sich das Bild wie im Schlaf ohne mich malte. Die Leere leuchtet verheißungsvoll, aber das sind Augenblicke. Schon der erste Strich ruiniert, was gerade noch vorstellbar war. Er zeigt das Lächerlichste. Und mit jedem weiteren Strich geht es weiter bergab. Der eine wirkt müde und jener, der ihn zu wecken versucht, kommt doch nur aus der Trickkiste der Effekte. Die Konservierung des Konservierten dreht sich wie auf einem alten Jahrmarktkarussell. Was tun, wenn alle Würfel schon im letzten Jahrhundert geworfen wurden? Zögern und Zaudern, kleine Bilder, Riesenbilder, Abstraktion und Sumpf der Ambition, Formalismus, Figuration, Tornados von Pigmenten oder Minimal, Flirts mit Technologie. Es ändern sich Inhalte und Bezüge, aber ihre Form bleibt am Boden kleben, als sei er mit einer fiesen Flüssigkeit bedeckt. Das Emoji aus Öl versucht sich zitternd aus dem Sumpf zu heben und zieht dabei lange Fäden wie ein Kaugummi. Pinselstriche als Identitätskrisen, wie geplatzte Kaugummiblasen auf den Lippen Fäden ziehen.
Kuratiert von Valérie Knoll.
Die Ausstellung wird großzügig gefördert durch:

Bild: Paul Coker Jr.
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Dominik Sittig, Galerie Nagel Draxler, Berlin / Köln / München. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Nolan Simon, Galerie Lars Friedrich, Berlin, 47 Canal, New York. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Vittorio Brodmann / Galerie Gregor Staiger, Zürich / Mailand. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy JUBG, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024 . Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Private Collection, Marseille. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Lorenza Longhi / Fanta-MLN, Mailand. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Galerie Karin Guenther, Hamburg / Galerie Nagel Draxler, Köln / Berlin / Zwinger Galerie, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Dominik Sittig / Galerie Nagel Draxler, Berlin / Köln / München. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Private Collection. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Zenner. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Dominik Sittig / Galerie Nagel Draxler, Berlin / Köln / München. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Vittorio Brodmann / Galerie Gregor Staiger, Zürich / Mailand. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Morag Keil. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Morag Keil. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Nora Kapfer. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Alfred d’Ursel / dépendance, Brüssel. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Alfred d’Ursel / dépendance, Brüssel. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Alfred d’Ursel, dépendance, Brüssel. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Alfred d’Ursel / dépendance, Brüssel. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Galerie Karin Guenther, Hamburg / Galerie Nagel Draxler, Köln / Berlin / Zwinger Galerie, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei, 2024. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Sophie Gogl, KOW, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 3: Albtraum Malerei. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2024. Courtesy Sophie Gogl / KOW, Berlin. Foto: Mareike Tocha.
-
Ausstellung: Jahresgaben 2023, 2. – 17.12.2023


Eröffnung: Freitag, 1. Dezember, 18 Uhr
Marie Angeletti, BLESS, Milena Büsch, Peter Fischli, Sylvie Fleury, Ryan Gander, Lorenza Longhi, Kaspar Müller, Vera Palme, Gunter Reski, Franz Erhard Walther, Nicole Wermers, Amelie von Wulffen, Barbara Zenner
Bestellungen der Jahresgaben 2023 können ab dem 1. Dezember 2023 bis einschließlich 17. Dezember 2023 schriftlich eingereicht werden. Gehen mehr Bestellungen ein, als Exemplare vorhanden sind, entscheidet das Los. Die Verlosung findet am 18. Dezember 2023 statt. Nach Auslosung des/der Käufer:in werden alle Interessenten über das Ergebnis der Auslosung schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Alle verbliebenen Jahresgaben stehen nach der Auslosung weiterhin zum Verkauf und können jederzeit erworben werden.
Die Jahresgaben und Editionen sind ein exklusives Angebot ausschließlich für die Mitglieder des Kölnischen Kunstvereins. Weitere Interessenten sind durch Eintritt in den Kölnischen Kunstverein im laufenden Kalenderjahr zum Erwerb berechtigt.
Bitte beachten Sie unsere Bestellbedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bild: Lorenza Longhi
-
Ausstellung: Hoi Köln, 2.12.2023 – 21.1.2024
 Teil 2: Im Bauch der Maschine
Teil 2: Im Bauch der Maschine
Marie Angeletti, Monika Baer, BLESS, Vittorio Brodmann, Jakob Buchner, Milena Büsch, Merlin Carpenter, Matthias Groebel, Fischli Weiss, Hansi Fuchs, Sophie Gogl, Hamishi Farah, Jacqueline Humphries, Dozie Kanu, Nora Kapfer, Morag Keil, Emil Michael Klein, Maggie Lee, Lorenza Longhi, Alan Michael, Kaspar Müller, Vera Palme, Gunter Reski, Jean-Frédéric Schnyder, Dennis Scholl, Nolan Simon, Lucie Stahl, Megan Francis Sullivan, Alfred d’Ursel, Amelie von Wulffen, Jie Xu, Barbara Zenner, Damon Zucconi
Die Künstliche Intelligenz macht große Schritte, generative Systeme erreichen neue Ebenen der Bild- und Textproduktion. Was bedeutet es für die Malerei, wenn sie von rechnenden Robotern hergestellt werden kann?
In der Vergangenheit bildeten technologische Sprünge oft der Beginn langer Phasen revolutionärer Häutungen der Kunst. Vor den Sprüngen konnte sich der Mensch noch einbilden, er besitze das Privileg, etwas zu können. Danach, plötzlich überholt von der Technologie, musste er sich nach der Decke strecken. Der Impressionismus verdankte sich den Wechselwirkungen mit der Erfindung der Fotografie und vieles in der postmodernen Malerei wurde angeregt durch die Erfahrung mit dem Computer. Gerade scheint wieder der Beginn einer solchen Phase auf, in der sich die menschengemachte Kunst an ihrem technologischen Spiegel abarbeiten muss. Was können diese Maschinen und wo kommen sie an ihre Grenzen? Mit der Frage, wie er sich von ihr unterscheidet, und der Suche nach seiner Nische schaut der Mensch durch die Maschine auf sich selbst.
Kuratiert von Valérie Knoll
Die Ausstellung wird großzügig gefördert von:

Bild: Mareike Tocha

Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Jacqueline Humphries, NMM…MMM, 2023. Courtesy die Künstlerin / the artist / Greene Naftali, New York / Stuart Shave / Modern Art, London / Galerie Gisela Capitain, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy die Künstlerin / dépendance, Brussels. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy die Künstlerin / dépendance, Brussels. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy der Künstler / Zwinger Galerie, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy der Künstler. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Atelier Groebel. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Collection of Alexander V. Petalas. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy BLESS. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Hansi Fuchs. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Hansi Fuchs. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy die Künstlerin / Jenny’s, New York. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy die Künstlerin / Greene Naftali, New York / Stuart Shave / Modern Art, London / Galerie Gisela Capitain, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy der Künstler / 47 Canal, New York. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Nolan Simon, The Loop (IN/OUT), 2022. Courtesy der Künstler / the artist / 47 Canal, New York. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy der Künstler / Galerie Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy der Künstler / Galerie Francesca Pia, Zürich. Foto: Mareike Tocha. 

Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy die Künstlerin / dépendance, Brussels. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy der Künstler / JTT, New York. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 2: Im Bauch der Maschine, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Jakob Buchner, 2022. Courtesy der Künstler / the artist. Foto: Mareike Tocha. -
Ausstellung: Hoi Köln, 29.9. – 19.11.2023
 Teil 1: Begrüßung des Raumes
Teil 1: Begrüßung des Raumes
Mit Marie Angeletti, Monika Baer, BLESS, Vittorio Brodmann, Jakob Buchner, Milena Büsch, Merlin Carpenter, Hamishi Farah, Fischli Weiss, Hansi Fuchs, Sophie Gogl, Matthias Groebel, Jacqueline Humphries, Dozie Kanu, Nora Kapfer, Morag Keil, Emil Michael Klein, Maggie Lee, Lorenza Longhi, Alan Michael, Kaspar Müller, Vera Palme, Gunter Reski, Jean-Frédéric Schnyder, Dennis Scholl, Nolan Simon, Lucie Stahl, Megan Francis Sullivan, Alfred d’Ursel, Amelie von Wulffen, Jie Xu, Barbara Zenner, Damon Zucconi
„Hoi“ sagen die Menschen, dort wo ich herkomme, wenn sie sich auf der Straße begrüßen. Nach Köln bin ich gekommen, da ich die Malerei liebe und ich keinen besseren Ort für die Auseinandersetzung mit diesem Medium wüsste. Darum begrüße ich diesen Raum mit einem Überblick über die Gegenwart einer der ältesten Gattungen der bildenden Kunst. Aufregend ist die Malerei gerade jetzt, nicht etwa wegen meiner Leidenschaft, sondern da wieder ganz viel gemalt wird und die offenen Fragen der Kunst erneut in Bewegung geraten sind. Das heißt nicht, die Fortsetzung der Malerei wäre ein leichtes Spiel. Auf ihrer neuen Blütezeit lastet wie ein hartes Gericht der lange Schatten ihrer Geschichte. Die Probleme kommen aber nicht nur von hinten, sie kommen auch von vorne. Da sich die Malerei langsam entwickelt, benötigt sie die Vorstellung einer ewigen Zukunft, in der ihre schleichenden Bewegungen irgendwann einmal ankommen können.
Gerade wirkt die Aussicht auf das Kommende nicht nur verhangen; es ist schwierig geworden, sich die Zukunft überhaupt vorzustellen. Wird vielleicht in der Hoffnung gemalt, dass jene Zukunft, die im Nebel der Dystopien und Untergangsszenarien kaum noch zu erkennen ist, wieder aufscheinen wird? Gegen das Gefühl einer bröckelnden Kontinuität weiterzumalen kann auch als Ausdruck eines „Prinzip Hoffnung“ betrachtet werden, das gewillt ist, gegen alle Widerstände einer Welt, die sich für das Dunkel entschieden hat, ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Malen wäre dann ein Handeln gegen den Strich, das mit einem zarten Lächeln aus der gesellschaftlichen Übereinkunft herausschwimmt.
Weiter lesenKuratiert von Valérie Knoll
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes wurde durch den Kölner Kulturrat in der Kategorie „Kulturereignis des Jahres 2023“ für den Kulturpreis nominiert.
Die Ausstellung wird großzügig gefördert von:

Bild: Basel Tourismus/Peter Ziegler

Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / BLESS. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Megan Francis Sullivan. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Private Collection. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Monika Baer / Galerie Barbara Weiss, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Hansi Fuchs. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy BLESS. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Megan Francis Sullivan. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Kaspar Müller / Galerie Francesca Pia, Zürich. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Kaspar Müller / Galerie Francesca Pia, Zürich. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy ZENNER. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy ZENNER. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Peric Collection / FELIX GAUDLITZ, Wien. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. NOT FOR SALE. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. NOT FOR SALE. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jean-Frédéric Schnyder / Galerie Eva Presenhuber, Zürich / Wien. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Private Collection, Marseille. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Emil Michael Klein / Galerie Francesca Pia, Zürich. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Emil Michael Klein / Galerie Francesca Pia, Zürich. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jakob Buchner. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jakob Buchner. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jakob Buchner. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jakob Buchner. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jean-Frédéric Schnyder / Galerie Eva Presenhuber, Zürich / Wien. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jean-Frédéric Schnyder / Galerie Eva Presenhuber, Zürich / Wien. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Courtesy Jean-Frédéric Schnyder / Galerie Eva Presenhuber, Zürich / Wien. Foto: Mareike Tocha. 
Hoi Köln, Teil 1: Begrüßung des Raumes, 2023. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2023. Foto: Mareike Tocha -
Einzelausstellung: Marie Angeletti – ram spin cram, 1.4. – 2.7.2023

In ihrer ersten institutionellen Ausstellung in Deutschland, ram spin cram (rammen drehen stopfen), präsentiert Marie Angeletti (*1984) neu geschaffene Werke im gesamten Gebäude des Kunstvereins.
Präzise artikuliert, erhält jedes Element — Skulptur, Photographie und Video — die gleiche Aufmerksamkeit. ram spin cram beginnt nicht in der Haupthalle und endet in den letzten Räumlichkeiten im Obergeschoss, sondern ist überall gleichzeitig zu erleben. Jeder Raum kann als eine Abfolge von Aktionen gelesen werden, die sich im Laufe der Zeit angehäuft haben. In der Haupthalle sind Werke aus den vergangenen zwei Monaten zu sehen. Im Kinosaal, im Ober- und Untergeschoss hat Angeletti Werke, die aus einer nicht näher bestimmten Periode stammen, neu arrangiert.
Danke an Nikola, Stefan, Line, Gianna, Henrik, Gérard, Anne, Anna, Olga, John, Michele, Dora, Matt, Tonio, Jakob, Lucas, Richard, Annie, Daniel, Jordan, Seb, Medhi, Toni, Pippa, Tim, Marco, Varun, Sol.
Danke Istal, Marseille, für die Finanzierung der Produktion der Metallpfeiler und Quadrissimo, Marseille, für die Silbergelatinedrucke und Daniela Taschen, die mich in Köln untergebracht hat.
Marie Angeletti (*1984, Marseille, lebt in New York) hatte u.a. Ausstellungen im Centre d’edition contemporain in Genf; im Künstlerhaus Bremen; Musée de la ville de Paris, Paris; Le Consortium, Dijon; im Kunsthaus Glarus; in der Kunsthalle Zürich; Treize, Paris; Castillo/Corrales, Paris und den Galerien Lars Friedrich, Berlin; Edouard Montassut, Paris; Reena Spaulings und Greene Naftali, New York.
Kuratiert von Nikola Dietrich

Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. 
Marie Angeletti, ram spin cram, 2023, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin. Marie Angeletti, Men at Work, 2023, Diashow, 12:45 min (Ausschnitt), Courtesy: Édouard Montassut, Paris / Galerie Lars Friedrich, Berlin Die Ausstellung wird gefördert von:

-
Ausstellung: Game of No Games, 13.11.2022 – 5.3.2023
 Anleitung zu beschwingtem Gehen
Anleitung zu beschwingtem Gehen
William Scott in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha. Die Ausstellung zeigt historische und zeitgenössische Werke von Künstler:innen, die in der Geschichte der Kunst kaum Beachtung fanden und deren Teilnahme an der Gesellschaft und im Kunstbetrieb, beispielsweise durch Vormundschaft, Entzug des Wahlrechts oder Diskriminierung eingeschränkt wurde und noch immer wird. Damit geht einher, dass meist keine stabile institutionelle Verankerung oder größere (Kunst-) Netzwerke und Supportsysteme verfügbar sind. Gängige Kategorisierungen, wie Outsider Art oder Art Brut, mit der parallelen Hervorhebung ihrer angeblichen Unterscheidungsmerkmale, die bislang häufig als Narrative von spontan vs. geplant, angeboren vs. erlernt, naiv vs. anspruchsvoll, oder etwa primitiv vs. modern gelesen werden, sind heute als überholt anzusehen und kritisch zu hinterfragen. Die Ausstellung möchte daher auch ein anderes Verständnis hinsichtlich etablierter Denkweisen der Kunstwelt und eine selbstverständlichere Ausstellungspraxis beziehungsweise Repräsentation bezüglich künstlerischer Praktiken erreichen.
Die im Kölnischen Kunstverein gezeigten Künstler:innen tauchen in ihren Werken in selbstentfremdende Rollenspiele ab, in denen sie andere Identitäten annehmen und eine Verwandlung – bis hin zur Tierwerdung – stattfindet. „Ich bin ein verdammter Jäger, aber ich weiß, dass es Unfrieden macht. … Ich muss es [das Unruhige] überdecken, damit ich weiter in der Gesellschaft überhaupt existieren kann“, sagte die Künstlerin Rabe perplexum (in „Experimente, Der unbekannte Künstler“, 1987), die in ihren Werken und Leben die Rolle eines Raben annimmt.
Es geht nicht darum, die hier vorgestellten Künstler:innen mit ihrer künstlerischen Praxis als gesellschaftlich ausgegrenzt zu positionieren, als Künstler:innen die hinter scheinbarer Weltabgewandtheit verdrängte Realitäten ausbreiten oder unterdrückte Sehnsüchte entfalten, viel mehr zeigt die Ausstellung, wie sie ganz bewusst mit ihren Abhängigkeiten arbeiten. So entwarf beispielsweise Adelhyd van Bender ein großes und vielschichtiges Werk, das die Welt in mathematische Formeln zerlegt und – durch Assoziationsketten mit biografischen Angaben verschränkend – eine neue Ordnung bildet. Als Vorlage für seine mehrfach kopierten und überarbeiteten Zeichnungen verwendete er häufig an ihn gerichtete Briefe von Ämtern, die von seinem steten Kampf gegen die Verlängerung seiner Vormundschaft zeugten.
Häufig positionieren sich diese Künstler:innen inmitten der Gesellschaft, genau in die Kunst-Unorte und Zwischenräume hinein, in der eine größere Öffentlichkeit vorzufinden ist, um sich zu ihr zu verhalten und mit einer ihnen jeweils eigenen Selbstverständlichkeit Kritik an ihr zu üben. Indem die Künstler:innen gesellschaftliche Konventionen, Normen und dominierende Traditionen verlassen und Gesellschafts- beziehungsweise Geschlechterinszenierungen unterminiert werden, stoßen sie häufig auf Unverständnis. So auch die Künstlerin Helga Goetze, die in den 70er Jahren aus einem konventionellen Lebensentwurf ausbrach und später vor der Gedächtniskirche in Berlin fast täglich freie Liebe, Sex und weibliche Lust propagierte.
Das radikale Potenzial der hier zusammengekommenen Werke liegt darin, uneingelöste politisch-soziale Versprechen einzufordern und, wie beispielsweise Dietrich Orth in einem der Ausstellung titelgebendem Werk anklingen lässt, Anleitungen und Vorschläge zu einem besseren, gerechteren Umgang miteinander zu geben. Aus ihnen wird eine tiefe, in die Zukunft weisende Sehnsucht erkennbar, die auch als Kritik an der Gegenwart verstanden werden kann.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich und Susanne Zander.
Mit den Künstler:innen Adelhyd van Bender, Klaus Beyer, Lee Godie, Helga Sophia Goetze, Margarethe Held, Dietrich Orth, Albert Leo Peil, Rabe perplexum, William Scott, Wendy Vainity und August Walla.
Abbildung: William Scott, Untitled, 2013, Courtesy of The Museum of Everything
Rabe perplexum, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
August Walla, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Privatsammlung und Sammlung Karin und Gerhard Dammann. Foto: Mareike Tocha. 
Dietrich Orth, Schuldkomplexknoten, undatiert. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Privatsammlung Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Dietrich Orth, Querschnitte von Schuhen zum sich Vorstellen beim Gehen, 1987. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Privatsammlung. Foto: Mareike Tocha. 
Klaus Beyer, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Frank Behnke-Archiv Klaus Beyer. Foto: Mareike Tocha. 
Klaus Beyer, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Frank Behnke-Archiv Klaus Beyer. Foto: Mareike Tocha. 
Dietrich Orth, Anleitung zu beschwingtem, freudigen Gehen, 1987. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Rezipink Collection. Foto: Mareike Tocha. 
Nicht Mann, nicht Frau, nur Rabe, 1984, 43 min, eine Katja Raganelli und Konrad Wickler Produktion. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
William Scott, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha 
William Scott, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha 
Margerethe Held, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Sammlung Zander. Foto: Mareike Tocha. 
Lee Godie, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha. 
Lee Godie, ohne Titel, undatiert. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha. 
Lee Godie, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything und Kapra Fleming. Foto: Mareike Tocha. 
Adelhyd van Bender, Aktenordner, Mischtechnik auf Fotokopie, um 1999–2014. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Nicole Delmes, Susanne Zander, Foto: Mareike Tocha. 
Adelhyd van Bender, Aktenordner, Mischtechnik auf Fotokopie, um 1999–2014. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Nicole Delmes, Susanne Zander, Foto: Mareike Tocha. 
Adelhyd van Bender, Aktenordner, Mischtechnik auf Fotokopie, um 1999–2014. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Nicole Delmes, Susanne Zander, Foto: Mareike Tocha. 
Adelhyd van Bender, Aktenordner, Mischtechnik auf Fotokopie, um 1999–2014. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Nicole Delmes, Susanne Zander, Foto: Mareike Tocha. 
Adelhyd van Bender, Aktenordner, Mischtechnik auf Fotokopie, um 1999–2014. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Nicole Delmes, Susanne Zander, Foto: Mareike Tocha. 
August Walla, recto: Schrifttafel-Teufel / verso: Aqua Hister. NSDAP.! Kuppel, 1984. Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Sammlung Karin und Gerhard Dammann, Schweiz. Foto: Mareike Tocha. 
Helga Sophia Goetze, Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Sammlung Karin Pott und Carmen und Daniel Klein. Foto: Mareike Tocha. 
Albert Leo Peil in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Albert Leo Peil in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Helga Sophia Goetze in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Carmen und Daniel Klein, Karin Pott und Privatsammlung. Foto: Mareike Tocha. 
August Walla, recto: Gott, Sabaoth, Zebaoth! / verso: Göttin Maria und Rosina Walla, 1985. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Sammlung Karin und Gerhard Dammann. Foto: Mareike Tocha. 
Adelhyd van Bender in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Nicole Delmes, Susanne Zander. Foto: Mareike Tocha. 
Lee Godie in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha. 
Lee Godie in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha. 
Wendy Vainity in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Wendy Vainity. Foto: Mareike Tocha. 
William Scott in Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: The Museum of Everything. Foto: Mareike Tocha. 
Dietrich Orth, Anleitung zu beschwingtem, freudigen Gehen, 1987. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: Rezipink Collection. Foto: Mareike Tocha. 
Game of No Games. Anleitung zu beschwingtem Gehen, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. Die Ausstellung wird gefördert von:

Weitere Unterstützung: Jan Fischer, Unternehmer und Förderer des Kölnischen Kunstvereins sowie der NRW Kunstvereins-Landschaft
-
Ausstellung: Jahresgaben 2022, 13.11. – 4.12.2022

mit Rosa Aiello, Genoveva Filipovic, Calla Henkel und Max Pitegoff, Manfred Holtfrerich, Erika Landström, Luzie Meyer, José Montealegre, Dala Nasser, Daniela Ortiz, Thomas Ruff, John Russell, Jasmin Werner
Eröffnung der Ausstellung: Samstag, 12.11.2022, 19 Uhr
Bestellungen der Jahresgaben 2022 können ab dem 12. November bis einschließlich 04. Dezember 2022 schriftlich eingereicht werden. Gehen mehr Bestellungen ein, als Exemplare vorhanden sind, entscheidet das Los. Die Verlosung findet am 05. Dezember 2022 statt. Nach Auslosung werden alle Interessent:innen über das Ergebnis per E-Mail benachrichtigt. Alle verbliebenen Jahresgaben stehen nach der Auslosung weiterhin zum Verkauf und können jederzeit erworben werden.
Die Jahresgaben und Editionen sind ein exklusives Angebot ausschließlich für die Mitglieder des Kölnischen Kunstvereins. Weitere Interessenten sind durch Eintritt in den Kölnischen Kunstverein im laufenden Kalenderjahr zum Erwerb berechtigt.
Bitte beachten Sie unsere Bestellbedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Ausstellung wird gefördert von:

-
Einzelausstellung: José Montealegre Nervous System, 20.8. – 16.10.2022

Eröffnung: Freitag, 19.8.2022, 19 Uhr
In seiner ersten institutionellen Einzelausstellung Nervous System im Kölnischen Kunstverein setzt José Montealegre seine 2020 begonnene Werkserie Páginas fort. Ausgangspunkt für diese Skulpturen ist ein umfangreiches botanisches Archiv mit Pflanzenabbildungen, das im Zuge der spanischen Kolonisierung Mexikos entstand und als Nova Plantarum Animalium et Mineralium Mexicanorum (1628) veröffentlicht wurde. Es umfasst Hunderte von indigenen Pflanzen, die von den Kolonisatoren katalogisiert und neu systematisiert wurden. Detailreich übersetzt Montealegre diese botanischen Illustrationen in Kupferskulpturen und präsentiert sie im zweiten Stock des Kunstvereins. In seiner künstlerischen Praxis, die auch das Schreiben umfasst, entwirft der Künstler Erzählungen, die die Grenze zwischen Herkunft und (Fehl-)Übersetzung verwischen. Entgegen dem von Kolonialmächten geprägten Wissen lässt Montealegre marginalisierte Perspektiven auftauchen und fordert so kanonische Geschichte(n) heraus.
Der Ausstellung folgt die erste Publikation von José Montealegre.
Methodologien I
Eins. Wie ein Protagonist einer Comic-Zeichnung, der in die rotierende Schnauze einer Gänsehaut-Stadt aus Beton wie zum Beispiel New York eintaucht, schnappt meine messingbeschlagene, lederne Aktentasche auf und alle meine Papiere fliegen weg. Jetzt bin ich spät dran. Jetzt bin ich arm. Jetzt habe ich Träume. Jetzt fliegen sie weg.
Zwei. Es ist furchtbar offensichtlich, dass jedes Gespräch über die Methodologien der Kunst mit dem Leben beginnt und sicher auch endet. Beginnt, weil es die Quelle ist, die den Brunnen anzapft. Endet, weil aufgeblähte Goldfische die Beute der Falken sind.
Drei. Dokumentenwirbelsturm. Scherenschnitt-Stadt. Der Nerv, die Nerven, nervöse Nerven aus Stahl. Der Tornado aus Seiten wirbelt Ordnung und Logik durcheinander und versetzt damit das Geschäftsgespräch in einen unverständlichen Schwebezustand, wo die Bürokratie keinen Halt findet und die Rankpflanze keine Wurzeln schlagen kann. Vielleicht hast du eine Nervenzelle, die fehlzündet.
Vier. Daraufhin wird mir klar, dass das, was gesucht wird, nicht zufällig sein kann. Eine Person, die das Loch in ihrer Tasche nicht stopft, nennt man Wohltäter:in.
Fünf. Es ist der sich drehende Papierzyklon, der mein Leben so zerstört hat, der Ort der Selbstauflösung der Welt. Wo das Unsichtbare nicht nur gesehen wird, sondern sich verwandelt. Die schwebenden Papiere werden zu Kugeln zerknüllt. Sie enthalten, verbergen und machen Informationen unbrauchbar. Es ist wie der Blick in den Brunnen und den goldenen Meniskus sehen, der das Licht bricht, die gegossene und verwelkende Blüte, die sanft auf die Wasseroberfläche fällt und vom Wind umhergeweht wird, der Goldfisch, der unbeholfen, wenn nicht gar anmutig schwimmt, und die Kralle, die ihre Ruhe bricht und sich ins Wasser stürzt und den Goldfisch in eine andere ekstatische Welt trägt.
Sechs. Im Mai 2020 lud ich eine digitale Kopie der Nova Plantarum Animalium et Mineralium Mexicanorum (1628) von Biodiversitylibrary.org auf einen USB-Stick herunter. Dann brachte ich diesen USB-Stick zu einer Druckerei für Studierende. Dort druckte ich sie in Schwarzweiß auf Recyclingpapier aus. Mit ledergebundenem Einband und allem Drum und Dran. Der 1.104 Seiten starke Dokumentenstapel enthält Hunderte von Zeichnungen von Pflanzen und Tieren aus dem heutigen Mexiko und Mittelamerika. Jede Zeichnung wird von einem Namen auf Nahuatl begleitet, der von den Imperien verstreut wurde, und einem lateinischen Namen, der von der modernen Botanik neu interpretiert wurde. Seit ich diese Version der ‚Nova Plantarum‘ gedruckt habe, blättere ich das Buch fast jeden Tag durch. Ich sehe mir die Pflanzen an und erkenne sie manchmal sofort. Manchmal dauert es aber auch Monate, bis mir klar wird, dass ich sie schon einmal gesehen habe, doch die meisten bleiben mir unbekannt. Wenn ich ihren Namen google, finde ich nichts. Nur durch diese Zeichnungen vertraut, sehe ich vage Möglichkeiten in der Landschaft. Wenn mir danach ist und wenn ich merke, dass ich sie bildhauerisch kenne, mache ich eine Skulptur der Zeichnung. Bis jetzt habe ich etwa achtzig Pflanzenskulpturen gemacht. Es sind noch Hunderte übrig. Jedes Mal, wenn ich die schwarz-weiße Druckausgabe dieses Buches durchblättere, schaffe ich darin eine neue Ordnung. Der Ledereinband befindet sich jetzt in der Mitte des Buches übersät von Kritzeleien und Notizen. Die Seitenabfolge ist unlogisch und irrelevant geworden. Die Seitenzahlen überspringen Hunderte. Ich habe Seiten verloren. Ich habe sie zerknittert. Ich habe Flecken hinterlassen.
Text: José Montealegre (Übersetzung: Kathrin Heinrich)
Methodologien II
Eins. Betrachten
Erster Blick an die weiße Wand, zweiter Blick auf den gefliesten Boden. Sich umschauen. Hinunterschauen. Geh auf die Knie. Geh näher heran. Entdecke. Wiederhole.
Zwei. Beanspruchen
Im Jahr 1517, während der spanischen Kolonisierung Amerikas, wurde der Naturforscher und Arzt Francisco Hernández de Toledo auf die erste wissenschaftliche und botanische Expedition geschickt. Das Ergebnis der siebenjährigen Expedition war ein umfangreiches botanisches Archiv in Form eines illustrierten Manuskripts mit schematischen Zeichnungen, die bei Nahua-Malern in Auftrag gegeben worden waren. In Folge wurde es im Kloster Escorial aufbewahrt, vom italienischen Mediziner Nardo Recchi umstrukturiert, ging bei einem Brand teilweise verloren und wurde schließlich 100 Jahre später unter dem Titel Nova Plantarum, Animalium, et Mineralium Mexicanorum historia im Jahr 1628 veröffentlicht.
Drei. Wissen
Sehen, Benennen, Wissen. Die Pflanzennamen im Buch sind sowohl in Nahuatl als auch in Latein angegeben. Da jedoch die Bezüge durch Aneignung, Erwerb und Übersetzung teilweise verloren gegangen sind, ist der Versuch, eine Entsprechung in der heutigen Botanik zu finden, nicht immer erfolgreich. Als wir durch die Kölner Innenstadt gehen, sehe ich eine auffallend dominante Pflanze, die den Bordstein durchbrochen hat. „Ist dir nicht aufgefallen, dass Pflastersteine in deutschen Städten immer bogenförmig verlegt sind?“, fragt er. Denken durch Handwerk.
Vier. Erzählen
Im Jahr 2013 besuchte ich José Montealegre zum ersten Mal in seinem Atelier. Er war gerade von Managua nach Frankfurt am Main gezogen, um sein Studium an der Städelschule in der Klasse von Willem de Rooij zu beginnen. Ich erinnere mich, wie ich Plattformen aus Kacheln auf niedrigen Sockeln auf dem Boden, auf denen Miniatur-Dschungelwelten aus Ton zu sehen waren, betrachtete, oder besser gesagt, beobachtete, an Reliefs von winzigen Skeletten an der Wand neben gerahmten, historisch anmutenden Buchseiten. Es war eine Überraschung, als ich herausfand, dass diese Dokumente fiktiv waren: Digitaldrucke auf leeren Seiten, die aus gebrauchten Büchern herausgerissen worden waren. Überschreiben von Geschichten. Geschichte neu schreiben. Die Erzählung zurückgewinnen.
Fünf. Ausweiten
Montealegres Werke haben das Potenzial, sich über ihre Ränder hinaus auszudehnen. Wie vier rechteckige Ausschnitte einer größeren Umgebung scheinen sie zu wachsen, sich zu entwickeln, sich zu reproduzieren. Im Außenraum reflektieren die spiegelnden Oberflächen der Plastikbehälter, die in Honduras zum Auffangen von Regenwasser und zur Handwäsche von Kleidung verwendet werden, ihre Umgebung. In den Buntglas-Quadraten klingen die Einflüsse der katholischen Ikonographie sowie des Kunsthandwerks und ihre alles vereinnahmende europäische Erzählung nach. Die Renaissance in Europa brachte nicht nur das Konzept der Perspektive in der Kunst mit sich, sondern auch die koloniale Expansion.
Sechs. Zusammenbrechen
Was Kupfer und Nerven gemeinsam haben, ist, dass beide elektrische Überträger sind. „Vertrau mir nicht, ich sage nicht die Wahrheit“, sagt er. Zittern und Beben. Wissen und Macht neu strukturieren. Rückkehr der Handlungsfähigkeit.
Text: Miriam Bettin (Übersetzung: Kathrin Heinrich)
Kuratorin: Miriam Bettin
José Montealegre(*1992 in Tegucigalpa, Honduras) lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte Philosophie und Literatur an der Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua, und bei Willem de Rooij an der Städelschule in Frankfurt am Main. Seine Arbeiten wurden in Einzelausstellungen in der Klosterruine in Berlin, bei Mountains in Berlin (beide 2021), Convent Art Space in Gent (2019) und in Gruppenausstellungen u.a. im Lantz’scher Skulpturenpark Lohausen in Düsseldorf (2021), Städelmuseum in Frankfurt am Main, bei Natalia Hug in Köln (beide 2019), Futura Gallery in Prag, Gillmeier Rech in Berlin (beide 2018) und in der Kunsthalle Darmstadt (2017, 2014) gezeigt. Parallel zur Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein ist eine von José Montealegre und Rebekka Seubert kuratierte Gruppenausstellung im Dortmunder Kunstverein zu sehen (bis 30.10.2022).
José Montealegre: Nervous System, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Nervous System, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Nervous System, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Nervous System, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 352, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 352, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 352, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 352, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página [missing], 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página [missing], 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página [missing], 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página [missing], 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Afterflood (Triptych), 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Afterflood (Triptych), 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 256 fg. 2, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 256 fg. 2, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 256 fg. 2, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 424 fg. 3, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 424 fg. 3, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Página 424 fg. 3, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Art History, 2018. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Art History, 2018. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Tainting the well, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Tainting the well, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Tainting the well, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
José Montealegre: Tainting the well, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Mountains, Berlin. Foto: Mareike Tocha.
Unterstützt von:
-
Einzelausstellung: John Russell CAVAPOOL, 20.8. – 16.10.2022

Eröffnung: Freitag, 19.8.2022, 19 Uhr
Hallo … hallo … wuff wuff wuff!
Meine Augen sind wie wässrige „Pools der Liebe“, den Tränen nahe, so kurz vor deiner Ankunft, wo ich hier oben stehe und warte… wuff wuff! Die Treppe hinuntersehe zu dir. … ein koketter Mischling.„Haaaaallo“, sagst du, während du die Treppe hochkommst, „Oh, du bist ja süß… was sollen wir zusammen machen?“
Und da schwingt etwas in meiner Gestik mit, in der halben Drehung meines Körpers, in der gefälligen Neigung meines Kopfes, in meiner leicht schrägen Haltung, in der geschickt gemalten Feuchtigkeit meiner Nase, in der handgearbeiteten Verführung meiner Locken und des Fells, selbst in der Andeutung eines koketten Lächelns, das um den Winkel meiner Schnauze spielt…
Wuff wuff!
Oh listige Nötigung!
Oh ausgefeilte Anspielung!
Und dann, während ich neben dir hertrotte, als dein Geisttier, wir den Hauptausstellungsraum betreten und den Duft von Pinien und vielleicht Sandelholz einatmen – Reinigungsmittel oder vielleicht Raumspray. Wuff wuff wuff! Und unter unseren Füßen der saftige Glanz von Spiegelbeton.„Oh, das ist erstaunlich!“, rufst du, als das Licht zu dir hereinbricht.
Der klaffende Einschnitt, hinunter bis zu Gesteinsbrocken, die Ansicht eines Wasserspektakels, einer Kluft inmitten verwobener Strudel aus Wellen, Wolken, Kliffen, Himmeln und überfluteter Architektur; barocke Loops aus flüssiger Verführung, wässrigem Tod und sonnenbeschienenen Kräuselungen. Der Horror der „Abbildung“, gezierte perspektivische Vortäuschung, die krude Aufforderung zur Darstellung des Bodens um der Darstellung Willen mit ihren Tricks und Rückwendungen und sich an der Oberfläche bewegenden Re-Animationen; Glanz und Glamour vermischen Sehnsucht mit Phantomen, wie Hochwasser oder Flut; „gearbeitet mit zeitaufwändiger Technik und Fertigkeit“ …wuff wuff! Ein Entwurf für schimmernde Oberflächen und Tiefen, offensichtlich verdichtet und vollgestopft mit Abstraktionen, immer nur einen Millimeter dick; schelmisch die mörderische Ideologie der „verführerischen Oberflächen und verborgenen Tiefen“ kritisierend.
Und währenddessen fühlt sich der Glanz auf meinen Pfoten so seltsam an. Ich jaule etwas und ihr alle lacht: „Oh, du bezauberndes Hündchen!“
Und als wir auf Zehenspitzen über den Boden des ehemaligen Gebäudes des British Council laufen, in dem sie einst britische Hochkultur aus der Zeit des Kalten Krieges präsentiert und gefördert haben. Oh, mein Hundeherz! Einerseits ist das ein ähnlich triviales Repräsentations-Spektakel … aber andererseits … nein … immer das! Immer nur das!
„Ha ha ha ha“, lachst du, als wir unseren Weg über den Graben fortsetzen. Und weiter hinten, horizontal und vertikal ausgerichtet, ist eine Reihe von Fliegenskulpturen über die Spannbreite hin angeordnet – eine Reihe von Satzzeichen, von schwarzen Punkten. Eine von ihnen ist vielleicht, mitten im Flug vor einer Blume eingefroren, eine Art „Anti-Biene“ … nicht die fröhliche, pelzige, orangefarbene, ökologische Bestäuberin, deren Summen erfreut, sondern eher Zeichen von Tod und Verfall nach Art des niederländischen Stilllebens, oder einfach nur das Geschmeiß, das sich im Dreck drängelt. Wuff wuff wuff! Oder bei näherer Betrachtung … bei näherer Betrachtung … Rorschach-Tintenkleckse … vielleicht kann man den Kopf von Max Wall entdecken, englischer Varieté-Star, berühmt für seine Rolle als Professor Wallofski, komödiantische Klaviereinlagen und Auftritte in Beckett-Stücken.
Oder vielleicht kann man mich in der Fliege erkennen, meine hinreißende Form ausmachen in … einer Cavafloo? Oder womöglich in einem bezaubernden Cavaflooloolooolooo, um vielleicht den Klang eines Singvogels zu imitieren. Wie auch immer….
„Cavafloolooloo…“ rufen wir aus, als wir weitergehen.
Während ich neben dir hertrotte, bei Fuß. Freudig. Mit einem Anschein von Liebe, wenn du zu mir runterschaust. Hüpfe ich die Treppen hinunter und stolpere mit einem Mal, ein Bündel Fell purzelt nach unten. Komme wieder auf die Füße. Zu viel der Säfte! Zu viel des Lebens!
„Wuff wuff … folge mir … hier unten“, rufe ich. So ein süßer Tour-Guide. Und abwärts.
„Oh, das ist wunderbar!“, tönst du.
Und so gehen wir hinunter in das Untergeschoss, das nur teilweise zugänglich und mit einem Seil abgesperrt ist. Ein Ziegenbock. Vom höheren Foyer aus erblickt. Und eine weitere Fliege, die auf dem Augenlid des Bocks sitzt (eine historisch ekstatische Fliege! Die gleiche Fliege, wie sie auf dem Augenlid von Margaret Thatcher saß, als sie starb).
Der Ziegenbock – das wohl am meisten verdammte Geschöpf, nicht zuletzt dank seiner wiederholten Verwendung in der Kunst. Oh, verfluchte Ausgeburt, wie oft muss sein Kadaver noch im künstlerischen Kontext wiederbelebt werden. Hervorgekehrt für den metaphorischen Affekt! Und da sind wir wieder und beobachten seine satirische Form, seinen zunächst traurigen Ausdruck, wie er über einen Felsvorsprung geklettert ist, das Ganze im Stil des deutschen mittelalterlichen Realismus gehalten. Pelzschichten, hervorgehoben in Öl und Glanzlack, wahrscheinlich die Reminiszenz an William Holman Hunts berühmtes Gemälde Sündenbock von 1892 verspottend, oder das Maskottchen des 1. FC Köln, das einmal von gegnerischen Fans angegriffen wurde. In seinem starren Blick auf die Betrachter:innen verstärkt sich die religiöse Pose noch (implizit). Aufgebläht mit Sünde; wie ein Sündenbock oder auf andere Formate von Kunst-Böcken verweisend, oder kulturelle Böcke, erotische, mythologische, okkulte etc. So wie es auch einfach nur ein Ziegenbock ist. Dieses bestimmte Bock-Beispiel hat seine ganz eigenen Potenziale. Und die Maden (Babyfliegen) auf den Beinen des Bocks und in den Schichten seines Pelzes.
Wuff wuff wufff! „OK OK ! Und wo gehen wir jetzt hin? Ha ha ha.“ Wir wollen weiter, als eine kleine Beunruhigung entsteht: „Sind wir Geister?“, kreischen wir alle. „Sind wir Phantome? Ha ha ha!“
Was für ein Spaß! Und wieder hinaufsteigend, in einer Spirale zurück nach oben. Vorbei an den Postern; Verquickungen von Verkaufsgesprächen, Supermarktgesprächen und Politik, wo an der Wand, im ersten Stock das gemalte Porträt des Ziegenbocks sitzt, als Flachrelief in Öl gearbeitet, im Stil oder Geiste des „Bildnis des Dorian Gray“, in dem der Protagonist jung und schön bleibt, während das Bildnis altert und verfällt. Dieser alte Bock lächelt uns in seiner schnurrbärtigen Gebrechlichkeit zu.
Und in der Nähe des Bock-Gemäldes das Gemälde eines Krähenvogels, der auf einem Baumstumpf sitzt und Ameisen vom Boden aufpickt. Die Ameisen arbeiten zusammen, werden aber von einer größeren Kraft über ihnen dahingerafft.
„Wuff wuff … dieser alte Krähenvogel … wenn ich meine Zähne in seine Federn schlagen könnte! Ha! Dann würde er meine Kraft fühlen … nur ein paar Sekunden, um ihn totzuschütteln! Ha ha! Wuff wuff!“
„Oh Liebling, wie brutal! Lass ihn … lass ihn … er ist es nicht wert!“
„Wuff wuff … gib mir nur eine Minute und ich werde dafür sorgen, dass er aufhört, an unserer gemeinsamen Arbeit herumzupicken! Ha ha! Wuff wuff!“
Wuff wuff! Und schließlich, ein letzter Besuch, eine letzte Etappe auf der Reise, ein letzter Refrain, ein letztes Treffen, noch ein Kapitel, noch einen Vers, ein Gebet, eine Predigt, einen Rausch, einen Traum… Ja, zum Kino! Das Theater der Träume! Ein Verweilen in der Dunkelheit. In den Schatten. Zwischen den projizierten Bildern auf der Leinwand. Die Krähe wird kurz eingeblendet und die Ameisen…und die Fliege hat einen flüchtigen Auftritt; durchtränkt von der glühenden Hitze im ländlichen Frankreich, inmitten schmelzender Pollen, Mücken und gerinnender Zeitgeschichte. Ja, du kannst dich zurücklehnen in die gepolsterten Sitze. Ich sollte vielleicht auf dem Gang hin- und herlaufen. Während wir einen „intensiven Dialog zwischen zwei Pendlern, einer nimmt die Form einer Giacometti-Skulptur an, choreographiert auf den Bahnsteigen einer Vorstadt-Station“ ansehen. Wie sie nach dem anspielungsreichen Eierkopf suchen.
Eierkopf will seine Eier zurück!
Eierkopf will … wuff wuff!
Schweißtreibende Intensität, warm bis in die Knochen, in dein Fleisch, in deinen Schädel und deine Zähne. Wuff wuff wuff wuff!
Und nun geht’s in Wellen abwärts. Wir strömen nach draußen. Und dann plätschernd, die Treppen hinabfließend und unter der Eingangstür durchsickernd, auf die Straße … fröhliche neue Cavapools auf der Straße, quer über den Bürgersteig, in Visionen hinunter durch den Beton, unter den Pflasterstein. Sanft plätschernde Wasser.
Oh Freude!Wuff wuff!
Text: John Russell (Übersetzung: Blandina Brösicke)
Kuratorin: Nikola Dietrich
John Russell (*1963 in London) studierte Kunstgeschichte am Goldsmiths College of Art und Bildende Kunst an der Slade School of Art und Saint Martin’s School of Art. Er war Mitbegründer der Künstlergruppe BANK, deren Mitglied er zehn Jahre lang war. Seit er BANK im Januar 2000 verließ, arbeitet Russell sowohl unabhängig und kollaborativ an der Produktion von Ausstellungen, kuratorischen Projekten und Künstlerpublikationen. Seine Arbeiten wurden in Einzelausstellungen gezeigt, unter anderem bei Bridget Donahue in New York (2021 und 2018), High Art inParis(2017), Kunsthalle Zürich (2017) und in Gruppenausstellungen in der Viborg Kunsthal, DK (2018), Gallery of Modern Art inGlasgow (2018), Galerie Crèvecoeur in Paris (2018), Irish Museum of Modern Art in Dublin (2017), Artists Space in New York (2014), The New Art Gallery Walsall, UK (2013), ICA in London (2011), Focal Point Gallery in Southend, UK (2011), The Grey Area in Brighton (2011), Kunsthalle Exnergasse in Wien, (2011), Tate Britain in London (2010) und Tate St Ives in Cornwall, UK (2009).
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapoo, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Flies, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Flies, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Scapegoat, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Scapegoat, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Scapegoat, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Scapegoat, 2022 (detail). Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapoo, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapoo, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Pain, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Pain, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapool, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Portrait of a goat in style of Dorian Gray, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Anti-bee, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Cavapoo, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Crows and ants, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Crows and ants, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: Crows and ants, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: EARLEY, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: EARLEY, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: EARLEY, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: EARLEY, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. 
John Russell: EARLEY, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler, Bridget Donahue, New York und High Art, Paris. Foto: Mareike Tocha. Unterstützt von:

-
Einzelausstellung: Dala Nasser – Red in Tooth, 14.5. – 26.6.2022

Eröffnung: Freitag, 13.5.2022, 19 Uhr
Der Kölnische Kunstverein freut sich, Dala Nassers erste institutionelle Einzelausstellung Red in Tooth zu präsentieren, die ihre gleichnamige mehrteilige Installation zeigt. Sie umfasst eine Videoarbeit, Patchwork-Malereien und eine in Zusammenarbeit mit dem Soundkünstler Mhamad Safa geschaffene, neuproduzierte Soundinstallation und ist Ausgangspunkt für Nassers anhaltende Auseinandersetzung mit dekolonialen Ökologien und Verflechtungen des Menschlichen und Nicht-Menschlichen. Sie ist somit im Sinne eines Vorschlags zur Erdung zu verstehen, um wieder jene Dinge hören, riechen, sehen und spüren zu können, die durch anhaltende Praktiken des Raubbaus und koloniale Auslöschung ausgeblendet und unsichtbar gemacht wurden.
Basierend auf ihrer Arbeitsweise als material- und prozessbasierte Künstlerin kultiviert Nasser durch Abstraktion und alternative Formen der Bildgestaltung ein notwendiges Unbehagen, indem sie wieder Vertrauen in das Land, seine Flüsse und seine nicht nur menschlichen Bewohner:innen setzt. Die Arbeiten folgen dem Fluss Al Wazzani, der durch den Südlibanon in die Palästinensischen Autonomiegebiete fließt. Auf dieser zersplitterten Reise ist Nasser gezwungen, von der staatlichen Straßeninfrastruktur abzuweichen, die gebaut wurde, um uns in ihren Bahnen zu halten. Sie ist gezwungen, dem Boden, seiner Farbe und seinem Geruch, dem Plätschern des Wassers und den anderen Bewohner:innen dieses Landes, den Tieren, durch die weiten, wilden, unberührten Landstriche des Südlibanon zu folgen, die uns zum grenzüberwindenden Wazzani führen. Diese Grenze, die mit ihren natürlichen Ressourcen und ihrer Tierwelt Leben hervorbringt, ist nur teilweise für einige wenige Familien zugänglich, die in der unmittelbaren Umgebung leben – und das unter schwierigen Bedingungen. Es ist (fast) unmöglich, Zeug:in der anhaltenden schleichenden Gewalt, der Enteignung und anderer kolonialer Praktiken unter ständig wechselnden, sich verändernden und sich wandelnden Bedingungen zu werden. Nassers Beharren darauf, sich bei ihrer fortlaufenden Aufgabe, andere mögliche soziale und politische Vorstellungen zu berücksichtigen, von anderen ökologischen Signifikanten leiten zu lassen, wirft die Frage auf, wie wir ökologisches, und mehr als nur menschliches Wissen um uns herum wahrnehmen. Wie können wir unsere Beziehung zum Land, zur Tierwelt und zu anderen Lebewesen neu kalibrieren, um einen Weg zu finden, ihren unausgesprochenen Zeugnissen Gehör zu schenken? Wie können wir von ihnen lernen, die Risse der starren kolonialen Strukturen zu navigieren – sowohl den materiellen Strukturen als auch jenen der kollektiven Erinnerung(en), Geschichte(n) und Archive?
Auf eine scheinbar rituelle Intuition Bezug nehmend wurden die Malereien in die Erde um den Wazzani eingegraben, mit gesammeltem Regenwasser gewaschen und/oder in Salzwasser gekocht; sie riechen nach leidvoller Erde und tragen angesammelte Materie in sich. Sie sind geprägt von einer anderen Erinnerung, Realität und Zukunft: Jahre der Erosion, der Abtragung, des Wasserverlusts, der Verschmutzung und des erhöhten Salzgehalts, durchdrungen von einer Geschichte des natürlichen Lebens, der Ausbeutung, des Todes, des Blutes, der Gewalt und des Landraubs. Sie sind ein Versuch, dem Boden, seinen Leiden und Hoffnungen, durch jene Umstände zuzuhören, die er wirklich erlebt hat und weiterhin überlebt. Die große Patchwork-Arbeit wurde für den Vortragssaal (Riphahnsaal) neu zusammengesetzt; hängend bilden die Malereien Kaskaden von der Bühne in die Mitte des Raums, wo sie disharmonisch auf die begleitende ortsspezifische Soundinstallation treffen. Diese Soundarbeit, eine Zusammenarbeit mit dem Soundkünstler und Architekten Mhamad Safa, manipuliert die Zeitlichkeit der Umgebung durch zeitbasierte Effekte. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das Knistern der Außenaufnahmen des Flusses und seiner Umgebung, auf die Vögel, die Grillen, den Wind. Das Resultat ist eine immersive, abstrahierte visuelle, akustische und olfaktorische Konditionierung, die uns zu einer langsameren, konzentrierteren Lektüre und Wahrnehmung anregt.
Im zweiten Raum verhandelt und offenbart die Videoarbeit andere Möglichkeiten des Seins und der Beziehung, die von den komplizierten Nuancen und Komplexitäten der dekolonialen Arten, des Terrains und der Tierwelt des Gebiets gelernt werden können. Der Film wird von Wildtieren als Zeugen erzählt, deren Berichte nicht aus Worten bestehen, und wechselt zwischen bewegten Aufnahmen einer viel befahrenen Straße, von Menschen produziertem Abfall, konstruierten Grenzen, politischen Schildern, bestehenden topografischen Markierungen, die als imaginäre Linien animiert werden, den Stimmen der Bewohner:innen, toten und lebenden Tieren und langen, schönen, trostlosen Bildern der Landschaften des Südlibanon und des nördlichen Palästinensischen Autonomiegebiets. Durch den gezielten Einsatz von Bildern und Klängen lässt Nasser zuweilen ein impressionistisches Werk entstehen, das uns in eine andere mögliche Lebensweise und gelebte Realität versetzt und aus ihr herausführt.
Die Ausstellung verlangt eine multisensorische Präsenz und Auseinandersetzung, da koloniale Praktiken und Landschaften in den Räumen auf einer materiellen, olfaktorischen, akustischen und visuellen Ebene abstrahiert werden. Red in Tooth erinnert uns daran, dass wir die falschen Entscheidungen getroffen haben, dass wir den falschen Materialien vertraut haben, dass wir zu lange auf die Aussagen derer gehört haben, die keine Zeug:innn gewesen sind. Die Ausstellung offenbart uns eine Machtdynamik, die zwischen kolonialen Strukturen, Menschen, Tieren, Pflanzen, dem Fluss und dem Boden gefangen ist, und lädt uns durch Nassers subtile, aber radikale Sprache der Abstraktion ein, verschiedene Formen der Mobilität und der Beziehung zum Land zu betrachten.
Text: Reem Shadid / Übersetzung: Kathrin HeinrichDie Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Dala Nasser (*1990 in Tyrus, lebt in Beirut, Libanon) hatte kürzlich Einzelausstellungen bei VO Curations in London und Deborah Schamoni in München (2022 und 2021). Sie nahm an einer Reihe von Gruppenausstellungen teil, darunter im Centre Pompidou in Paris (2022), in der Villa Emplain in Brüssel (2021), im Beirut Art Center (2019), im Bétonsalon – Centre d’art et de recherche in Paris (2019), bei Victoria Miro in London (2018), in der François Ghebaly Gallery in Los Angeles (2018) und bei ACT2 der Sharjah Biennale 13 (2017).
Dala Nasser: Red in Tooth, 2022. Design: Leen Charafeddine. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2022, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2020 – 2021 – 2022 (detail). Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2021. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2021. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
Dala Nasser: Red in Tooth, 2021. Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Deborah Schamoni. Foto: Mareike Tocha. 
-
Einzelausstellung: Loretta Fahrenholz - Gap Years, 19.3. – 26.6.2022

Eröffnung der Ausstellung: Freitag, 18.03.2022, 19 UhrGap Year: eine Auszeit von Arbeit und Verantwortung, eine Pause, bevor es wieder losgeht – oder ein bisschen Zeit, die einem in den Schoß fällt, wenn die Gesellschaft unerwartet stehen bleibt.
Das Tempelhofer Feld ist ein weitläufiger und relativ unkontrollierter Raum, der von historischen Brüchen geprägt ist. Es diente bereits im 19. Jh. als Naherholungsgebiet, gleichzeitig aber auch als Parade- und Militärgelände, es war ein Flughafen, Massenversammlungsort während der NS-Zeit, beherbergte ein KZ sowie den ersten Fußballtrainingsplatz in Deutschland.
Loretta Fahrenholz’ Fotoserie Gap Years portraitiert Freizeitaktivitäten während der Pandemie, als das Feld spontan zum Café, Fitnessstudio, Bar, Club und Pick-up-Spot umfunktioniert wurde. Aufgenommen mittels stroboskopartiger Zeitrafferaufnahmen, die Bewegungen wie in gefrorenem Gelee festhalten, zeigen die Arbeiten der Serie Leute beim Kampfsport, beim Tischtennisspielen, Rollschuhlaufen oder bei improvisierten Raves, beim Lenken ferngesteuerter Autos, bei Open-Air-Bondage und beim Picknick. Auch eine unscharfe Nahaufnahme von Tahini, das auf einen der unbeliebten E-Scooter gegossen wird, ist darunter (ja, wir sind hier unter reizbaren Berlinern).
Die Aktualität dieser Aktivitäten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Freizeitmotiv ein Belle Époque’sches Moment der Idylle innewohnt – das, was Fahrenholz als „Kitsch“ bezeichnet. Machen wir uns keine Illusionen über Freizeitaktivitäten. Als wohldosierte Unterbrechungen des Arbeitsregimes können sie das beste Mittel sein, um aus dem Alltag auszubrechen. In einem urbanen Kontext ist die Zurschaustellung von solch beiläufig virtuosen street skills zudem bereits in eine vielschichtige visuelle Ökonomie eingeschrieben: Fahrenholz‘ Fotos zeichnen dabei sowohl den für Instagram typischen Stil des Social-Media-Selbstkonsums als auch die Heroik der Sportfotografie nach. Der soziale Kollaps während der Pandemie ermöglichte dennoch auch andere Rhythmen, eine gesellschaftliche Neuordnung auf der Mikroebene, wodurch Räume entstehen konnten, die sowohl Dystopie als auch Utopie in sich vereinen.
Der Film Happy Birthday (2022) ahmt mit seinem einzelnen Protagonisten, der ziellos über das Tempelhofer Feld wandert, die Perspektive eines Ego-Shooter-Videospiels nach. In kleinen Fenstern erscheinen Schnipsel von mit dem Handy aufgenommenen Geburtstagsgrüßen. Im weiteren Verlauf des Films verdunkelt sich die einsame soziale Choreografie, eine Nicht-Feier mit Nachrichten aus der Ferne von Freunden und Familie, die eigentlich anwesend sein sollten. Die ausdruckslose Miene des Geburtstagskindes und die Abwesenheit einer Handlung erzeugen das Gefühl von emotionalem Druck und Erwartungen, während die Luft um ihn herum von Liedern, Ermutigungen oder Beschimpfungen, geteilten Erinnerungen, zweideutigen Botschaften und existenziellen Gedankenschleifen perforiert wird.
Was ist geblieben, wo stehen wir jetzt? Wohin gehen wir von hier aus? – Diese Fragen steigen aus der Dunkelheit empor, die die Figuren in den beiden Werken von Fahrenholz umgibt. Für Henri Lefebvre ist der „Rhythmusanalytiker“ jemand, der Rhythmen als Struktur für die Erfahrung von Raum und Zeit untersucht – jemand, der auf „alle möglichen bereits bekannten Praktiken“ hört, aber vor allem „auf seinen Körper; er lernt den Rhythmus von ihm, um folglich die äußeren Rhythmen zu schätzen. Sein Körper dient ihm als Metronom.“ Was würde Lefebvres Rhythmusanalytiker aus der pandemischen Zeit machen, einer Zeit, die aus dem Gleichgewicht geraten ist? Lefebvres Vorstellung vom Körper als Metronom bekommt eine andere Bedeutung, wenn man sie mit den gleichförmigen Bewegungen des Happy-Birthday-Protagonisten und den fotografischen Experimenten von Gjon Mili aus der Mitte des 20. Jahrhunderts vergleicht, die Fahrenholz zu ihrer Gap Years-Serie inspirierten. Die neue Stroboskoptechnik ermöglichte es Mili, die Sequenzen der menschlichen Bewegungen in einem einzigen fotografischen Bild festzuhalten: Picasso, der mit Licht eine Zeichnung anfertigt, der Schritt eines Balletttänzers über die Bühne. Bei Mili handelt es sich demnach um eine Art Porträt, bei dem die Psychologie zugunsten der Geschwindigkeit reduziert oder sogar ausgelöscht wird.
In der Gegenkultur der 1960er Jahre wurde das staccatoartige Aufblitzen des Stroboskops genutzt, um die Zeit zu zerhacken und den Körper aufzulösen. Tom Wolfe beschreibt die Tanzfläche eines „Acid-Tests“ der 1960er Jahre:
Ekstatische Tänzer – ihre Hände flogen von den Armen, erstarrten in der Luft – eine schimmernde Ellipse von Zähnen hier, ein Paar gepufferte, betonte Wangenknochen dort – alles flimmerte und zerfiel in Bilder wie in einem alten Flackerfilm – ein Mann in Scheiben! – die ganze Geschichte angepinnt auf eine Schmetterlingstafel; die Erfahrung natürlich.
Die psychedelische Sensibilität für die nicht-menschliche Seite der Technologie inspirierte den Filmemacher Jonas Mekas zu der Aussage, dass „da es in [dem Stroboskop] nichts außer weißem Licht gibt, es den Punkt des Todes oder des Nichts darstellt.“
Aber das Stroboskop ist nicht nur ein visuelles Schrapnell, sondern hat auch eine theoretische Komponente, eine kristalline, urfilmische Logik: „Man könnte sogar sagen, dass es das Licht selbst dramatisiert.“ Auf dem schmalen Grat zwischen Emanzipation und Kontrolle, Stimulus und Trauma fasst das Stroboskop den modernen Ansturm auf das Nervensystem von konstant wechselnden Signalen zusammen. In den 1950er Jahren wurden Flicker-Technologien für die elektroenzephalografische Forschung eingesetzt, um zu dokumentieren, dass Veränderungen der elektrischen Rhythmen des Gehirns einen diagnostischen Wert haben. Im Klick-Regime des Nerven-Gehirns unseres digitalen Zeitalters haben solche Stimuli auch einen hohen Tauschwert.
Wie Gilles Deleuze am Beispiel von Hélène Cixous beschreibt, kann „stroboskopisches Schreiben wahnwitzige Geschwindigkeiten“ auslösen, „bei denen sich verschiedene Themen miteinander verbinden und die Wörter je nach Lesetempo und Assoziationsweise verschiedene Figuren bilden.“ So gelingt es Cixous, sich aus patriarchalen Regimen herauszuschreiben. Bei Fahrenholz wird das kalte Lichte des Stroboskops gleichermaßen zur Poetik, eine passende Ästhetik für unsere traumlose Zeit. In Abkehr von der Beschleunigung und Cixous‘ Forderung nach „mehr Körper“ präsentiert Fahrenholz stattdessen Überlegungen zur Auflösung der Normalität und zu Zäsuren in der sozialen Raum-Zeit. Tradierte Lebensrhythmen geraten ins Wanken, wenn uns in den affektiven Zwischenräumen von Körpern und Technologien eine neue Kost der (Un-)Verkörperung, der Trennung und des Zusammenseins verschrieben wird. Vielleicht können wir hier, in einer großen räumlichen und zeitlichen Leerstelle wie dem Tempelhofer Feld während der Pandemie, alles, was geschieht – oder nicht geschieht – als Ereignis anerkennen und der Zukunft anvertrauen, damit sie neue Wege beschreiten kann.
Lars Bang Larsen (übersetzt von Kathrin Heinrich)
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.

Loretta Fahrenholz, 2021/22. Courtesy: the artist and gallery Buchholz.

Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Happy Birthday, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Happy Birthday, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: A Trip to the Sea, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2021/2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Gap Years, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: Green Hour, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: documenta Dream, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
Loretta Fahrenholz: documenta Dream, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Buchholz. Foto: Mareike Tocha. 
-
Ausstellung: Pure Fiction - Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths, 12.2. – 6.3.2022

Pure Fiction: Rosa Aiello (in Kollaboration mit Dylan Aiello), Ellen Yeon Kim, Erika Landström, Luzie Meyer, Mark von Schlegell
Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths
An Exhibition at the End of Performance (Eine Ausstellung zum Ende der Performance)
Eröffnung: Freitag, 11. Februar 2022, 17 – 21 Uhr
Performances ab 19 Uhr
Ausstellungsende: Sonntag, 6. März 2022, 11 – 18 Uhr
Performances ab 14 Uhr
Es gilt die 2G-Regel. Keine Anmeldung erforderlich.
In der nah am heutigen Neapel gelegenen Sibyllenhöhle findet die Ich-Erzählerin von Mary Shelleys Roman Der letzte Mensch von 1826 eine Ansammlung von Prophezeiungen, die auf einzelne, lose verteilte Eichenblätter gekritzelt wurden. Diese Fragmente beschwören die Geschichte einer großen Seuche herauf, deren verheerende Kraft in den 2100er Jahren über den gesamten Erdball fegt und die Menschheitsgeschichte für immer verändert. Der letzte Mensch gilt als erste Science-Fiction-Apokalypse und handelt von Einsamkeit, Wandlungen der Intimität, kontinuierlicher Wiederholung und dem Leben am Rande einer Epoche.In Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths, reagieren Mitglieder des Schreib- und Performance-Kollektivs Pure Fiction – Rosa Aiello (in Kollaboration mit Dylan Aiello), Ellen Yeon Kim, Erika Landström, Luzie Meyer und Mark von Schegell – auf die derzeit unberechenbare Kulturlandschaft, indem sie die bemerkenswert relevanten Motive aus Shelleys Roman in eine Inszenierung aus Sound, Installation, Vortrag, Film und Marionettentheater überführen. Prophetische Stimmen hauchen dem Abwesenden Leben ein, verleihen ephemeren Erscheinungen und Kräften Präsenz. Symbole werden in Handlungen transformiert, Handlungen in Symbole verwandelt.
In einer Zeit, in der das räumliche Beisammensein als Gruppe nahezu unmöglich erscheint, gewinnt es an neuer Bedeutung, innerhalb dieser Trennung Zusammenhalte zu schaffen; sich gewissermaßen miteinander auseinanderzusetzen. Wie die fragmentarischen Vorhersagen aus der Sibyllenhöhle erwachen die eigens für diese Ausstellung konzipierten künstlerischen Arbeiten in unterschiedlichen Stadien zum Leben, jeweils gemäß des eigenen inneren Skripts und der eigenen Zeitlichkeit. Die unterschiedlichen Ansätze entfalten sich in einer sorgfältigen Betrachtung des Wo? und des Wer?. Durch die Mehrstimmigkeit dieses dissonanten Chors hindurch erklingt deutlich vernehmbar ein gemeinsames Anliegen: Was ist Performance?
Im Erdgeschoss des Kölnischen Kunstvereins entfaltet sich die raumgreifende Soundinstallation von Ellen Yeon Kim in regelmäßigen Abständen; eine neue Videoarbeit von Luzie Meyer wird von Marionetten der aktuellen Pure Fiction Mitglieder begleitet; und in REAL BOOKS, einem temporären Büchergeschäft ohne zeitliche oder räumliche Bindung, unterbreitet Mark von Schlegell den Besucher:innen sein Angebot, das geschriebene Wort als Zeitmaschine zu nutzen – jedoch: Alles hat seinen Preis.
Im angrenzenden Kino begibt sich Rosa Aiello (in Zusammenarbeit mit Dylan Aiello) in inzestuöse Verstrickungen und macht von den libidinösen Potentialen der Performance Gebrauch (gleichermaßen auf und neben der Leinwand). Währenddessen inszeniert Erika Landström im ehemaligen Radioraum im zweiten Stock eine Traumfabrik der räumlichen Exploration und der kognitiven Arbeit.
Am Eröffnungstag und zum Ausstellungsende findet ein Live-Performanceprogramm statt.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Rosa Aiello (*1987 in Kanada) ist Künstlerin, Autorin und Filmemacherin. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Institutionen und Galerien gezeigt, darunter die Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main, Cell Project Space in London, Bureau des Réalités in Brüssel, und die Stadtgalerie Bern. In jüngster Zeit hatte sie Einzelausstellungen bei DREI in Köln, Arcadia Missa in London, Lodos in Mexiko-Stadt und Southern Alberta Art Gallery in Lethbridge. Ihre Texte wurden bei Triple Canopy, Starship, CanadianArt, Art Papers, Public Journal und F. R. David veröffentlicht.Ellen Yeon Kim (*1985 in Südkorea) studierte an der Städelschule in Frankfurt am Main in der Klasse von Peter Fischli und Simon Starling und an der Slade School of Art, UCL. Ihre ästhetisch komplexen Arbeiten enthüllen die Absurdität der vielfältigen, unvereinbaren Erwartungen, die von der Gesellschaft und ihren Institutionen an den Einzelnen gestellt werden. Sie zeigt auf, wie Traumata weitergegeben und vom Einzelnen selbst aufrechterhalten werden. Kims Praxis umfasst verschiedene Medien, darunter Theater, Stand-up-Comedy, Installationen und Zeichnungen. Sie wurde 2021 mit dem Peter-Mertes-Stipendium ausgezeichnet und ist seit 2019 Teil des Atelierprogramms im Kölnischen Kunstverein.
Erika Landström (*1984 in Schweden) ist eine Künstlerin, die in den Bereichen Skulptur, Installation und Performance arbeitet. Sie ist Absolventin der Städelschule in Frankfurt am Main und des Whitney Museum of American Art’s Independent Study Program in New York. Ihre jüngste Performance Holders wurde 2020 in der Emily Harvey Foundation in New York uraufgeführt. Sie hat u.a. bei Sternberg Press und Texte Zur Kunst publiziert und ihre Texte reichen von Lyrik bis zu Kunstkritik. Ihre Arbeiten wurden international in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt.
Luzie Meyer (*1990 in Deutschland) ist Künstlerin, Dichterin, Musikerin und Übersetzerin und lebt in Berlin. Sie studierte Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt und machte 2016 ihren Abschluss in Bildender Kunst an der Städelschule in Frankfurt am Main. Ihre Arbeiten wurden international in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. 2018 wurde sie mit dem Atelieraufenthalt der Hessischen Kulturstiftung an der Cité internationale des arts in Paris ausgezeichnet. Sie erhielt ein Pre-Doktoranden-Stipendium des DiGiTal-Fonds Berlin im Jahr 2020 sowie ein Forschungsstipendium des Berliner Senats im Jahr 2021 für ihr Forschungsprojekt „Unthinking Metatheatre“.
Mark von Schlegell (*1967 in den USA) ist Romanautor, Kritiker und Künstler und lebt seit 2005 in Köln. Sein erster Roman Venusia (2005) wurde für den Otherwise Prize in Science Fiction ausgezeichnet. Auf Englisch sind seine Texte bei Semiotext(e) und Sternberg Press erschienen, auf Deutsch bei Matthes und Seitz und dem Merve Verlag. Seine visuelle Kunst wurde in den USA (New York), Südkorea (Seoul), Dänemark und in Deutschland ausgestellt. Seit 2011 ist er Gründungsmitglied des Pure Fiction Kollektivs und unterrichtete Kunst und Literatur am CalArts in Valencia, dem San Francisco Art Institute und der Städelschule in Frankfurt am Main.

Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths, 2022. Bild von Aislinn McNamara. 
Erika Landström: I WILL NOT WRITE BACK, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: I WILL NOT WRITE BACK, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
Luzie Meyer: What happens when one looks, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Luzie Meyer: What happens when one looks, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
Mark von Schlegell: REAL ///// BOOKS, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Jan Kaps. Foto: Mareike Tocha. 
Mark von Schlegell: REAL ///// BOOKS, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Jan Kaps. Foto: Mareike Tocha. 
Mark von Schlegell: REAL ///// BOOKS, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Jan Kaps. Foto: Mareike Tocha. 
REAL / BOOKS. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
REAL / BOOKS. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
REAL / BOOKS. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
Ellen Yeon Kim: Jane, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
Luzie Meyer: The suns of my benighted soul.; To receive as a good morrow the mute wailing of one’s own hapless heart.; I called myself hopeless, yet still I hoped.; Oh! Grief is fantastic., alle 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und Sweetwater, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Ellen Yeon Kim: Jane, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Ellen Yeon Kim: Jane, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
PURE FICTION Shifting Theatre: Sibyl’s Mouths. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
REAL / BOOKS. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello: Winter Treasure, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello: Winter Treasure, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello: Winter Treasure, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: Immediate. Transportation. Elsewhere., 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: Immediate. Transportation. Elsewhere., 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: Immediate. Transportation. Elsewhere., 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: Immediate. Transportation. Elsewhere., 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: the relationship was “stable,” 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: Immediate. Transportation. Elsewhere., 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: the relationship was “stable,” 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: the relationship was “stable,” 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: the relationship was “stable,” 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Erika Landström: the relationship was “stable,” 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Filmstill. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Filmstill. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Filmstill. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Rosa Aiello und Dylan Aiello: The Last Man, 2022. Filmstill. Courtesy: die Künstlerin und DREI, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Mark von Schlegell: REAL ///// BOOKS, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Mark von Schlegell: REAL ///// BOOKS, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2022. Courtesy: der Künstler und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. Gefördert durch:

-
Ausstellung: Jahresgaben 2021, 8. – 19.12.2021

Künstler:innen:
Naama Arad, Inessa Emmer, Sabrina Fritsch, Stefani Glauber, Selma Gültoprak, Melike Kara, Ellen Yeon Kim, Rory Pilgrim, Nora Schultz, Cally Spooner, Katja Tönnissen, Mark von Schlegell
Wir freuen uns Ihnen vom 8. bis 19. Dezember 2021 zu den regulären Öffnungszeiten unsere diesjährigen Jahresgaben im Kölnischen Kunstverein zu präsentieren und laden Sie in diesem Rahmen ganz herzlich zu einem Rundgang mit der Direktorin Nikola Dietrich am Donnerstag, 9. Dezember um 17 Uhr ein. Eine Anmeldung sowie die Vorlage eines 2G-Nachweises sind erforderlich. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Besuch unserer Ausstellungen und Veranstaltungen.
Die jungen wie etablierten regionalen und internationalen Künstler:innen, die den Kölnischen Kunstverein in diesem Jahr mit einer Jahresgabe unterstützen, waren zum Teil im Jahresprogramm 2021 vertreten, sind aktuelle Atelierstipendiat:innen oder dem Kunstverein in anderer Weise verbunden.
Informationen zu den Künstler:innen und den zu erwerbenden Werken finden Sie unter Aktuelle Jahresgaben.
Bestellungen der Jahresgaben 2021 können ab jenem Zeitpunkt bis einschließlich 19. Dezember schriftlich eingereicht werden. Gehen mehr Bestellungen ein, als Exemplare vorhanden sind, entscheidet das Los. Die Verlosung findet am 20. Dezember 2021 statt. Nach Auslosung werden alle Interessent:innen über das Ergebnis schriftlich benachrichtigt. Alle verbliebenen Jahresgaben stehen nach der Auslosung weiterhin zum Verkauf und können jederzeit erworben werden. Nur für Mitglieder erhältlich.
Jahresgaben 2021. Installationsansicht. Foto: Alwin Lay. 
Jahresgaben 2021. Installationsansicht Selma Gültoprak. Foto: Alwin Lay. 
Jahresgaben 2021. Installationsansicht Cally Spooner. Foto: Alwin Lay. 
Jahresgaben 2021. Installationsansicht. Foto: Alwin Lay. 
Jahresgaben 2021. Installationsansicht. Foto: Alwin Lay. -
Einzelausstellung: Melike Kara – Nothing is Yours, Everything Is You, 13.11. – 5.12.2021

Eröffnung der Ausstellung: Freitag, 12.11.2021, 17 – 21 Uhr
Unter dem Titel Nothing is Yours, Everything Is You präsentiert Melike Kara neue Malereien in einer ortsspezifischen Installation aus Fotografien ihres persönlichen Archivs, das Familienbilder sowie weitere Quellen versammelt. Es dient als inoffizielle historische Dokumentation der kurdischen Diaspora, die weder Mittel noch Ressourcen hat, um ihre eigene Geschichte zu bewahren. Die mit Bleichmittel behandelte und verblasste Tapete im Studio des Kölnischen Kunstvereins hält Rituale und Traditionen, Erinnerungen und Erzählungen fest, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und sich gegen das Vergessen wehren.
Ihre Malereien, als Triptychon im Außenbereich zu sehen, sind gestisch-abstrakte Bildkompositionen aus hybriden Formen und Figuren und lehnen sich an die Formsprache von Textilprodukten kurdischer Stämme an, darunter eine spezielle Teppichknüpftechnik. Kara verwebt die Geschichte westlicher Malerei mit Einflüssen indigener Kulturen und hebt die überholte strikte Kategorisierung von Kunst und Handwerk auf.
Im Rahmen der Ausstellung findet am Donnerstag, 18. November 2021 um 18 Uhr eine Präsentation der Publikation WHERE WE MEET, 2021 (Ausst. Kat. Jan Kaps, Wiels Brüssel, Hg. Fabian Schöneich, Grafik: Anne Stock, 83 Seiten) mit Filmscreenings, Installation und einer Einführung von Fabian Schöneich statt.Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Melike Kara (*1985 in Bensberg, lebt in Köln) hatte Einzelausstellungen bei LC Queisser in Tbilisi (2021), Jan Kaps in Köln (2020), Arcadia Missa in London, im Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam (beide 2019), im Yuz Museum in Shanghai (2018) und Gruppenausstellungen u.a. im Ludwig Forum in Aachen, auf der Belgrad Biennale (beide 2021), bei Wiels in Brüssel und bei blank projects in Kapstadt (beide 2020).
Gefördert durch:

Melike Kara, Kölnischer Kunstverein, 2021. 
Melike Kara: Nothing Is Yours, Everything Is You, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: kiillim of seneh, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: Nothing Is Yours, Everything Is You, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: collective memories, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: sofreh normadic, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: bridge ties, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: vaster than sky, 2021. Detail. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: where we meet, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: malatya medaillon (kurd), 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: where we meet, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: where we meet, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. 
Melike Kara: sandanaj, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Jan Kaps, Köln. Foto: Mareike Tocha. -
Einzelausstellung: Daniela Ortiz – Nurtured by the defeat of the colonizers our seeds will raise, 13.11.2021 – 30.1.2022

Eröffnung der Ausstellung: Freitag, 12.11.2021, 17 – 21 Uhr
In Malereien, Textilarbeiten, Kinderbüchern und Installationen entwickelt Daniela Ortiz antirassistische und antikoloniale Erzählungen als Gegenentwurf zu Kolonialismen, die sich bis heute kontinuierlich fortschreiben. Sie konfrontiert jene Akteur:innen und Machtinhaber:innen, die für den institutionellen und strukturellen Rassismus verantwortlich sind und der sich u.a. in der missbräuchlichen und menschenrechtsverletzenden Kontrolle von Zuwanderung und Grenzen äußert. Die Konzentration auf handwerkliche Medien in Ortiz‘ künstlerischer Praxis entspringt ihrem zunehmendem Interesse, sich von der Ästhetik eurozentrischer Konzeptkunst zu entfernen.
Die Präsentation im Kölnischen Kunstverein ist die erste institutionelle Einzelausstellung von Daniela Ortiz in Deutschland und zeigt unter dem Titel Nurtured by the defeat of the colonizers our seeds will raise („Genährt durch die Niederlage der Kolonisatoren wird unsere Saat aufgehen“) neue, kontextspezifische Werkserien zusammen mit bestehenden Arbeiten. Begleitend erscheint das Künstlerinbuch The Rebellion of the Roots, 2021 (Hg. Kölnischer Kunstverein, Grafik: Ronnie Fueglister mit Yves Graber, 80 Seiten), das zur Eröffnung der Ausstellung vorliegt.Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Daniela Ortiz‘ (*1985 in Cusco, lebt in Urubamba, Perú) Arbeiten waren in internationalen Einzelausstellungen u.a. bei La Virreina. Centre de la Imatge in Barcelona (2019), Las Ataranzas in Valencia, im Middlesbrough Institute of Modern Art in Middlesbrough (beide 2017), im Van Abbemuseum in Eindhoven (2016), àngels barcelona in Barcelona (2014) sowie in Gruppenausstellungen im LUM – Lugar de la Memoria in Lima, in der KADIST art foundation in Paris, der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) in Berlin, in der Kunsthalle Wien (alle 2021) und im Kunstverein Hamburg (2020) zu sehen.
Gefördert durch:

Daniela Ortiz, Kölnischer Kunstverein, 2021. 
Daniela Ortiz: The children are not of the wolf, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und àngels, barcelona. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: The children are not of the wolf, 2021. Detail. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und àngels, barcelona. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: Nurtured by the defeat of the colonizers our seeds will raise, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: Nurtured by the defeat of the colonizers our seeds will raise, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: Samuel and Naseb, a resistance story in seven pranks, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin und àngels barcelona. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: The Rebellion of the Roots, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: The Rebellion of the Roots, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: Collection of Charlotte and Herbert S. Wagner III. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: The Rebellion of the Roots, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: Collection AkzoNobel Art Foundation. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: ABC of Racist Europe, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: ABC of Racist Europe, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Foto: Mareike Tocha. 
Daniela Ortiz: ABC of Racist Europe, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Foto: Mareike Tocha. -
Ausstellung: Guilty Curtain, 21.8. – 24.10.2021


Ursula Burghardt: Ohne Titel (Reitstiefel), 1968, Foto: Stiftung Kunstfonds. (c) Nachlass Ursula Burghardt. Künstler*innen: Etti Abergel, Naama Arad und Tchelet Ram, Julie Becker, Ursula Burghardt, Noa Glazer, Omer Halperin, Gizela Mickiewicz, Oren Pinhassi, Michal Samama, Nora Schultz, Noa Schwartz, Lior Shachar
Eröffnung: Freitag, 20.8.2021, 15 – 21 UhrGuilty Curtain ist eine ortsspezifische Installation, die für den historischen Raum des Kölnischen Kunstvereins konzipiert wurde. Im Inneren der langen, transparenten Ausstellungshalle wird eine Gruppenausstellung die Form eines Glashauses annehmen. Die gezeigten Kunstwerke basieren auf surrealistischen Begriffen wie Verdecken und/oder Ersetzen. Diese Gesten, die von den Künstler*innen anhand verschiedener Objekte und Materialien ausgeführt werden, enden nicht in einer Sackgasse. Die Umhüllung eines Toasters in Schafwolle deckt eine verwickelte Beziehung auf – anstatt das Schaf in den Ofen zu stecken, wird der Ofen vom Schaf verschlungen. Diese Mischung aus Material, Worten und Kategorien verweist auf eine symbiotische Beziehung zwischen Körper und Objekt. Während der modernistische Versuch, die Trennung zwischen Innen und Außen aufzulösen, am Ende nur die Kluft betonte, untergräbt das, was durch die Ansammlung all dieser körperlichen Objekte offengelegt wird, die architektonische Struktur des Kunstvereins selbst; so wie man den Raum erfahren wird, ist die Natur in diesem besonderen Glashaus kein Außen mehr.
Die umfangreiche Gruppenausstellung und Veranstaltungsreihe vereint hauptsächlich aus Israel stammende Künstler*innen mit weiteren aus Polen, Deutschland und den USA. In enger Zusammenarbeit mit der israelischen Künstlerin und Kuratorin Naama Arad konzipiert, wird eine lokale und aktive Kunstszene, die sich vor allem in Tel Aviv gebildet hat, im Kölnischen Kunstverein präsentiert.
Kuratiert von Naama Arad und Nikola Dietrich
Bitte beachten Sie die Informationen zu Ihrem Ausstellungsbesuch gemäß der gültigen Coronaschutzverordnung.Die Ausstellung wird gefördert durch:

Mit weiterer Unterstützung von:

Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen. Foto: Mareike Tocha. 
Naama Arad und Tchelet Ram: In Search of Lost Time, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerinnen. Foto: Mareike Tocha. 
Naama Arad und Tchelet Ram: If Looks Could Kill, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerinnen. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen. Foto: Mareike Tocha. 
Naama Arad und Tchelet Ram: Internet, 2020 (Detail). Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerinnen. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen und Sommer Contemporary Art, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Sommer Contemporary Art, Tel Aviv und Stereo, Warschau. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Sommer Contemporary Art, Tel Aviv und Stereo, Warschau. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Stiftung Kunstfonds und Becker-Biberstein Collection, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Stiftung Kunstfonds und Becker-Biberstein Collection, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Stiftung Kunstfonds und Becker-Biberstein Collection, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Stiftung Kunstfonds und Becker-Biberstein Collection, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Stiftung Kunstfonds und Becker-Biberstein Collection, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen, Stiftung Kunstfonds und Becker-Biberstein Collection, Tel Aviv. Foto: Mareike Tocha. 
Noa Schwartz: Window, 2016 und Ursula Burghardt: Bratpfanne; Suppenteller, beide 1969. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerinnen und Stiftung Kunstfonds. Foto: Mareike Tocha. 
Nora Schultz: Soundcrust 4 und Not an Ear 1, beide 2021. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Nora Schultz: Not an Ear 1 + 2, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Nora Schultz: Not an Ear 3, 2021. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen. Foto: Mareike Tocha. 
Naama Arad und Tchelet Ram: Brainstorming, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerinnen. Foto: Mareike Tocha. 
Naama Arad und Tchelet Ram: Brainstorming, 2020 (Detail). Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerinnen. Foto: Mareike Tocha. 
Guilty Curtain, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstler*innen und Privatsammlung. Foto: Mareike Tocha. 
Julie Becker: Interior corner #3 und #5, 1993. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: Privatsammlung. Foto: Mareike Tocha. 
Michal Samama: Lament of Plastic, 2014. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Courtesy: die Künstlerin. Foto: Mareike Tocha.
-
Ausstellung: reboot: responsiveness, 12.5.2021 – 8.6.2022

reboot: responsiveness ist der erste Zyklus von reboot: – einem kollaborativen, zyklischen, antirassistischen und queer-feministischen Dialog zwischen performativen und forschungsbasierten Praktiken, der gemeinsam vom Kölnischen Kunstverein und Ludwig Forum für internationale Kunst, Aachen präsentiert wird.
reboot:
Konzipiert von Eva Birkenstock, Nikola Dietrich und Viktor Neumann
Kernkollektiv: Alex Baczynski-Jenkins, Gürsoy Doğtaş, Klara Lidén, Ewa Majewska, Rory Pilgrim, Cally Spooner und Mariana Valencia
Graphikdesign von Sean Yendrys
Weitere Informationen unter folgendem Link. Alle bisherigen Veranstaltungen sind im Archiv einsehbar. Kommende Termine werden über unseren Kalender bekannt gegeben.
reboot: responsiveness ist eine Kooperation von:
reboot: responsiveness wird unterstützt von:
-
Einzelausstellung: Genoveva Filipovic – Seufzer, 27.3. – 4.7.2021

Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung ist bis zum 4. Juli 2021 verlängert. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise zu den geltenden Coronaschutzmaßnahmen.
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Mitteilung kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Kölnische Kunstverein, Die Brücke, in der nächsten Zeit überhaupt betreten werden und die Ausstellung Seufzer überhaupt ein Publikum finden kann, ob die Ausstellung von Genoveva Filipovic eventuell nur von außen zu sehen sein wird.
„…Wenn er sich unglücklicherweise zum Sprechen zwang, sagte er nur die albernsten Dinge. Zu allem Elend sah er auch selber seine Lächerlichkeit und hielt sie für schlimmer, als sie war; doch was er nicht sah, war der Ausdruck seiner Augen; sie waren so schön und verrieten eine so glühende Seele, dass sie, wie bei guten Schauspielern, manchen Dingen einen bezaubernden Sinn verliehen, die gar keinen hatten… nur dann gelang, etwas Vernünftiges zu sagen, wenn er durch irgendein unvorhergesehenes Ereignis abgelenkt, ein Kompliment nicht erst sorgfältig vorbereitete.“
Stendhal, Rot und SchwarzKonzept
Ich habe Kaktusse hergestellt und in eine Reihe gestellt.
Nachdem diese Arbeit beendet war, habe ich den Gesichtsausdruck jedes einzelnen Kaktusses so geändert, dass er meiner Meinung nach ein Seufzen auslösen könnte.
Da mir das als zu schwierig vorkam, habe ich nun dies gemacht: Ich habe behauptet, dass ich den Gesichtsausdruck jedes einzelnen Kaktusses so ändere, dass er meiner Meinung nach ein Seufzen auslösen könnte. Habe aber stattdessen ein Lächeln eingebaut.Dann versuche ich mir vorzustellen wie es wäre, wenn ich diese Szene “nachspielen würde”.
Very Ralph
Der Künstler möchte keine ErklärungsbrückeDie Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Genoveva Filipovic (*1986 in Frankfurt am Main) lebt in New York und zurzeit in Köln. Sie studierte an der HfG in Offenbach am Main sowie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt am Main (bis 2013). Ihre Arbeiten waren zuletzt zu sehen in der Galleria Federico Vavassori in Milan (2019), der Kunsthalle Zürich (2019), bei Goton in Paris (2018), Dead Ends in New York (2016), Vilma Gold in London (2016) sowie Neue Alte Brücke in Frankfurt am Main (2014).
Die Ausstellung wird unterstützt von:



Genoveva Filipovic: Seufzer, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha. 
Genoveva Filipovic: Seufzer, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha. 
Genoveva Filipovic: Seufzer, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha. 
Genoveva Filipovic: Seufzer, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha. 
Genoveva Filipovic: Seufzer, 2021. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2021. Foto: Mareike Tocha.
-
Ausstellung: Jahresgaben 2020, 17.11.2020 – 31.1.2021

Wir freuen uns, Ihnen ab Dienstag, 17. November die Jahresgaben 2020 vorerst online vorzustellen. Erhältlich sind exklusiv für den Kunstverein produzierte oder gestiftete Werke von jungen wie etablierten Künstler*innen:
John Baldessari, Kenneth Bergfeld, Tom Burr, Hanne Darboven, Dunja Herzog, Dorothy Iannone, Emma LaMorte, Marcel Odenbach, Lena Anouk Philipp, Luc Tuymans, Jeff Wall
Mit dem Kauf einer Jahresgabe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung zeitgenössischer Kunst und Künstler*innen sowie zur Arbeit des Kölnischen Kunstvereins. Dafür bedanken wir uns recht herzlich!
Bestellungen der Jahresgaben 2020 können ab dem 17. November 2020 bis einschließlich 6. Januar 2021 schriftlich eingereicht werden. Gehen mehr Bestellungen ein, als Exemplare vorhanden sind, entscheidet das Los. Die Verlosung findet am 7. Januar 2021 statt.
Bitte beachten Sie, dass die Jahresgaben ausschließlich von Mitgliedern des Kölnischen Kunstvereins erworben werden können. Die ausführlichen Bestellbedingungen finden Sie hier.Aktuell und noch bis zum 20. Dezember 2020 bleibt der Kölnische Kunstverein gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geschlossen. Sobald wir unsere Türen wieder für Besucher*innen öffnen können, werden die Jahresgaben im Rahmen einer Ausstellung im 2. OG zu besichtigen sein.
Über Neuigkeiten zur Wiederöffnung und zu unserem Programm halten wir Sie über Webseite und Newsletter auf dem Laufenden.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Lena Anouk Philipp: Ums Mark reisen, 2017. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020, Kölnischer Kunstverein. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Kenneth Bergfeld: Everything seems to need us (the ocean doesn‘t care) I – III, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Lena Anouk Philipp: Ums Mark reisen, 2017; Schwelen, 2018; Schwingen, 2018. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Marcel Odenbach: Ohne Titel, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Hanne Darboven: Künstlicher Marmor, Kirche Neuenfelde, Harburg Elbe Nord 1998. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
John Baldessari: Give me a B, give me an A … & etc., 2009. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Luc Tuymans: Wenn der Frühling kommt, 2008. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Jahresgaben 2020: Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha.
-
Ausstellung: THE KÖLN CONCERT – Dorothy Iannone & Juliette Blightman, 31.10.2020 – 7.3.2021


Dorothy Iannone, (Ta)Rot Pack, 2016, Double-sided laser copies mounted on cardboard, from 54 original drawings from 1968/69. 27 × (26,5 × 20 cm). Courtesy Air de Paris, Romainville. // Juliette Blightman, Stages of Seed Development, 2020, pencil on paper, photographic print, gouache, 28 × (27,4 × 20,8 cm). Courtesy Juliette Blightman and Arcadia Missa, London. Eröffnung am Freitag, 30.10.2020, 15 – 21 Uhr
„Ein Bild, höher noch als Engel: The Köln Concert“
Ein Text von Amelia Stein
Das Leben hat kein Außerhalb, verkünden die psyche-himmlischen Ladies of Liberty mit ihren Mikrofonen, sagen die prächtigen Kakteenbrunnen, sagt die blühende Pussyblume mit einem untrüglichen Augenzwinkern.
Dieses ist das Übereinkommen, das The Köln Concert zwischen Publikum, Werken und den Künstlerinnen inszeniert; sowohl Juliette Blightman (*1980) als auch Dorothy Iannone (*1933) komprimieren den Fluss der Zeit zu komplexen symbolischen Welten, in denen es um Liebe, Sex, Fürsorge, Arbeit, Autonomie, Freude und andere Aspekte des Selbstseins geht. Wenn ich „symbolisch“ sage, so meine ich Bilder, die allgemeine Aussagen treffen und sich zugleich auf Persönliches konzentrieren, die zum Teil mnemonisch und zum Teil prophetisch sind, in denen Frühstück und Jugendstil gleichberechtigte Existenzen führen und Geschichten den Platz der Nasen einnehmen. In The Köln Concert sind Formen, Figuren, Botschaften zu einer vielstimmigen Komposition arrangiert; das Leitmotiv, in dem Harmonien mit schrilleren Tönen kollidieren, ist von Blightman und Iannone auf eine Weise inszeniert, dass auch sie selbst ihrerseits das Zusammenspiel der Klänge zu hören vermögen.
Nicht dass alles und jedes zur Praxis gehört, aber auf alle Fälle ist dies eine Praxis, die netzförmig angelegt ist: Blightman entwickelte die Brunnen in der Garage ihres Stiefvaters, vielleicht mit der Hilfe ihrer kleinen Tochter. Es ist leicht möglich, sich ihren Besuch im Baumarkt vorzustellen, wo sie die Farbe auswählt, ein grelles, aber irgendwie zweckmäßiges Grün. Hier in der Welt der praktischen Dinge, die auch die Welt der Zweckentfremdungen, die der ausgelassenen Späße und der Notlösungen ist, sind die matten Eruptionen der Phalli davon abhängig, wie viel Energie sich von Sonnenkollektoren beziehen lässt. Während sie im Ruhezustand verharren, halten sie in Planschbecken Hof, in deren Rundungen sie unweigerlich im Chor auftreten. Irgendetwas wächst immer in Blightmans Werk heran, was bedeutet, es bedarf der sorgsamen Pflege. Das gilt für Kinder und Pflanzen, aber auch für Beschränkungen und Perspektiven, Begehren, das gefühlte Selbst: Fürsorge bedeutet Strukturen zu schaffen, bedeutet, Subjekt und Prozess als ein und dasselbe zu begreifen. „Tochter“ ist ein Prozess, ebenso „Körper“, das „Zuhause“. Die Bleistift- und Gouache-Arbeiten in Stages of Seed Development (2020) stellen sich zunächst als Fenster dar, bis die Serialität ihrer Anordnung alsdann etwas Gewichtigeres nahelegt: Phrasen womöglich, die zugleich unbestimmt und abgeschlossen sind.
Nachdrücklich sprechen, singen diese Arbeiten, bewegen sich auf ihre Inspirationsquelle zu, (Ta)Rot Pack (2016/1968-69). Iannones ekstatische Allegorie ihres Lebens mit Dieter Roth bringt eine Reihe eigener musikalischer Phrasen hervor: „This Card Brings a Brief Respite Maybe“, lässt ein nackter Roth verlauten, der auf einem trippigen Schweizer Pfad wandert. „This Card Brings What Everyone Wants“, sagen die geschmückten Liebenden in tantrischer Umarmung. Iannone hat erklärt, dass diese Fähigkeit – Dinge herbeizubringen – die einzige Art und Weise ist, wie ihre Karten das (andere) Tarot zu spiegeln vermögen. Ich hingegen würde eine andere Deutung wagen: dass nämlich ihr (Ta)Rot Pack, wie Blightmans Stages, eine Würdigung alltäglicher Konsequenzen ist – eine, die eines Anflugs kosmischen Humors nicht entbehrt.
Etwas, das mit Wanderschaft zu tun haben könnte, hier als unterschwellig hörbare Kadenz. Diese Werke entspringen Orten, die ebenso geliebt werden, wie man sie schlichtweg erträgt. Bei allem Umherreisen entspringen sie dem Bedürfnis, gelegentlich an diese zurückzukehren – etwa in die Vereinigten Staaten, wo Iannone und ihre Ladies of Liberty geboren wurden, oder auch nach Deutschland, wo Blightman zuerst ihre Tochter großzog und sie zuerst malte, und insbesondere ins Rheinland, wo Iannone mit Roth lebte und Ende der 1960er Jahre mit der Arbeit am (Ta)Rot Pack begann. Bild ist, wie man dort hingelangt: The Story Of Bern (Or) Showing Colors (1970), ursprünglich ein Künstlerbuch, in The Köln Concert als Diaporama gezeigt, liefert uns den Beweis, dass die fruchtbarsten Zeiten häufig die sind, die von Auseinandersetzungen und Kämpfen geprägt werden. Und dass am Ende, wenn wir aus all dem Chaos schließlich wieder auftauchen, wir nur rein theoretisch zu der Erkenntnis gelangen können, dass irgendwo in der Ferne Ruhm und Ehre auf uns warten.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Im Laufe der Ausstellung entsteht eine gemeinsame Publikation.
Die Präsentation im Kölnischen Kunstverein ist eine Weiterführung der Ausstellung Prologue bei Arcadia Missa in diesem Jahr. Eine zweite Version der Ausstellung wird im April 2021 bei Vleeshal in Middelburg, Niederlande, eröffnen.Dank an: Air de Paris, Romainville; Arcadia Missa, London; Peres Projects, Berlin; Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin; Galerie Fons Welters, Amsterdam; Sammlung Alexander Schröder, Berlin; Roger Hobbs; Kentaurus, Köln
Die Ausstellung wird unterstützt von:


Links: Dorothy Iannone, (Ta)Rot Pack, 2016, Double-sided laser copies mounted on cardboard, from 54 original drawings from 1968/69. 27 × (26,5 × 20 cm). Courtesy Air de Paris, Romainville. Rechts: Juliette Blightman, Stages of Seed Development, 2020, pencil on paper, photographic print, gouache, 28 × (27,4 × 20,8 cm). Courtesy Juliette Blightman and Arcadia Missa, London. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightman: Jouissance #1, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightman: Pussy Flower, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: My Liberties (Red), 2019 und Lord Liberty, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin, Peres Projects, Berlin und Air de Paris, Romainville. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: Lord Liberty, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin, Peres Projects, Berlin. 
Dorothy Iannone: The Statue of Liberty, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Peres Projects, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: (Ta)Rot Pack, 1968-69/2016, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Air de Paris, Romainville. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightman: Diseaseeds and Pollutionation, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Arcadia Missa, London. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: My Liberties (Blonde), 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin, Peres Projects, Berlin und Air de Paris, Romainville. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: My Liberties (Blonde), 2019 und Lady Liberty, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin, Peres Projects, Berlin und Air de Paris, Romainville. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: Lady Liberty, 2019. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin, Peres Projects, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightman: Stages of Seed Development, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Arcadia Missa, London. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightman: mirror would do well to reflect more before sending back images, 2009. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Sammlung Alexander Schröder, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightmam: mirror would do well to reflect more before sending back images, 2009. Stuhl/Spiegel, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Sammlung Alexander Schröder, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone: The Story of Bern (Or) Showing Colors, 1970. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Air de Paris, Romainville. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightmam: À rebours (the), 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Juliette Blightmam: À rebours (the), 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. 
Dorothy Iannone & Juliette Blightman: The Köln Concert, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Foto: Mareike Tocha. 
Links: Dorothy Iannone: Pinup Girl, 1966/2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: Dorothy Iannone, Foto: James Phineas Upham. Links: Juliette Blightman. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020. Courtesy: die Künstlerin und Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Foto: Mareike Tocha. -
Einzelausstellung: Dunja Herzog – Meanwhile, 5.9. – 18.10.2020

Mit der Einzelausstellung Meanwhile von Dunja Herzog realisiert der Kölnische Kunstverein eine umfangreiche Ausstellung der Künstlerin, die von einem Programm mit Filmvorführungen, Künstlergesprächen, Performance, Kinderworkshop und einer Stadtführung des in Köln ansässigen Frauengeschichtsvereins begleitet wird. Verschiedene Elemente und Themen unterschiedlicher Zeitlichkeiten und Hintergründe werden in einer ortsspezifischen Gesamtinstallation zusammengeführt, in der sie nebeneinander bestehen und miteinander in Bezug treten.
Die Ausstellung ist eine Weiterführung der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kupferhandels, wie sie im Besonderen im Projekt Red Gold von der Künstlerin in Hinsicht auf die allgegenwärtige systematische Ausbeutung im globalen kapitalistischen Projekt behandelt und hier in neuen Arbeiten fortgeschrieben wird. Dabei richtet sie den Blick auf die weiter zurück liegende Vergangenheit: ins Mittelalter und die frühe Neuzeit, auf die Geschichte der Hexenverfolgung und der Kupfergewinnung in Europa (z.B. durch die Reproduktion eines Holzschnitts aus dem 16. Jh. von Georg Agricola mit der Darstellung von Minen für den Kupferabbau sowie eines Hexentanzes auf dem Blocksberg im Harz). Gleichzeitig gibt es Verweise auf Mechanismen kommerziellen Profits, um sich heute global agierende ökonomische Systeme zu vergegenwärtigen, genauso wie Betrachtungen zur Rolle der Frau und der Thematik der Reproduktion im Übergang zum Kapitalismus anzustellen. Ihre persönlichen Hintergründe als Schweizerin sind dabei wesentlich, wurde das Frauenstimmrecht in der Schweiz als eines der letzten europäischen Länder erst 1971 wirksam (im Kanton Appenzell sogar erst ab 1990), ebenso die Rolle der Schweiz in dem System der imperialen Ausbeutung.
Das Material Kupfer zählt nicht zuletzt zu einer der wichtigsten globalen Wirtschaftsindikatoren mit seinem Haupthandelsplatz in der Schweiz seit 2011; die fünf größten Schweizer Firmen sind im Rohstoffhandel tätig. In einer neuen Videoarbeit der Künstlerin wird ein geografischer sowie zeitlicher Bogen vom Copperbelt in Sambia (eine Region mit dem bedeutendsten Kupferabbaugebiet in Afrika, in der auch die Schweizer Firma Glencore Minen betreibt) zu einer Kupfermine im Harz gezogen, in der das größte Kupfervorkommen Deutschlands existierte. In 165 Metern Tiefe ist ein Film entstanden, der die vom Licht beschienene Stollendecke bei einer Fahrt aus dem Stollen heraus zeigt – einen Rückzug aus der Mine und dem dort ehemals betriebenen Raubbau an der Natur und am Menschen. Für die Künstlerin sind Fragen von Ressourcen, Mining, Ausbeutung und Handel zentral: Wie kam es, dass sich die Kulturgeschichte in Europa von einer Verehrung der Natur zu ihrer Ausbeutung wandelte und dann im Sinne einer „Logik der Ausbeutung“ von Europa aus in die ganze Welt getragen wurde?
Die Welt, in der Gewalt, Fremdherrschaft und Profit vorherrscht und unsere Beziehung zur Erde bzw. wie von ihr Gebrauch gemacht und Missbrauch betrieben wird, sieht die Künstlerin synonym dazu, wie mit Körpern und deren emotionalen „Landschaften” umgegangen wird. Je mehr Ressourcen, unter anderem eben Kupfer – ohne dieses Material ist unsere zeitgenössische digitale Welt nicht denkbar – abgebaut werden, desto mehr scheint die Suche resp. die Verbindung zu inneren Ressourcen relevant.
Diese verschieden aufgeworfenen Themen und die mit ihnen einhergehenden Geschichten, die fast immer von Gewalt sprechen, werden in der Ausstellung nicht notwendigerweise direkt benannt oder gar wiederholt. Sie werden vielmehr über die verwendeten Materialien präsent gehalten, die in Bezug zu ihrer Herkunft, ihrem Gebrauch, ihrer historischen Relevanz, ihrer Entwicklung und den Handelswegen, welche über die Zeit sehr physisch unsere Gesellschaft geprägt hat. So sind für die Ausstellung auch Körbe aus Elektroschrott-Kupferdraht in Kollaboration mit Korbflechtern aus Benin in Lagos entstanden, eine Stadt, die zu einer der größten elektronischen Dumpingsites in West-Afrika gehört; nicht nur, um das Material aus einer bestimmten Wertschöpfungskette herauszulösen und es in eine andere zu transponieren, sondern um mit den Körben auch gleichzeitig eine Hommage an die Frauen Nigerias sowie Sambias zu geben, die einen wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit beider Länder geliefert haben. Dies scheint besonders wichtig in Bezug wiederum zum Gebäude des Kölnischen Kunstvereins selbst, war doch dieses auch noch zur Kolonialzeit der Briten Sitz des British Councils – Die Brücke -, das nach dem Krieg eine „Brücke“ zur Welt propagierte.
Von der Künstlerin wird ein Raum geschaffen, in gewisser Hinsicht ein „Dritter Raum“, in dem ein größeres Spektrum von Geschichten in ihren komplexen Zusammenhängen von Materie, Stofflichem und ihrer Wandlung und Beziehung zu den Menschen, erfahrbar gemacht wird und andere Sichtweisen ermöglicht. Aus den zur Sprache kommenden Materialien und Pflanzen gewinnt sie gewissermaßen die Essenz der ihnen innewohnenden Energien und Logiken, macht sie physisch wahrnehmbar und verweist damit letztendlich auch auf ihre heilbringenden Fähigkeiten.
Zur Ausstellung sind zwei Editionen erschienen: Death of Nature und Sea field.
Dunja Herzog (*1976 in Basel, Schweiz) lebte im letzten Jahr in Lagos, Nigeria, wo sie einige der im Kölnischen Kunstverein präsentierten Werkkomplexe schuf. Ihre Arbeiten wurden u.a. gezeigt im Kunstverein Göttingen; Swiss Art Awards, Basel (beide 2018); Lagos Biennale, Lagos, Nigeria (2017); BLOK art space, Istanbul; 1646, Den Haag (alle 2016); New Bretagne / Belle Air, Essen und im MAXXI Museum, Rom (beide 2015)
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Mit freundlicher Unterstützung durch:


Dunja Herzog, 2020. Foto: André Fuchs. 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha. 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha 
Dunja Herzog: Meanwhile, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Dunja Herzog. Foto: Mareike Tocha -
Einzelausstellung: Emma LaMorte – Aussicht, 5.9. – 18.10.2020

In ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung nimmt sich Emma LaMorte der Architektur des Kölnischen Kunstvereins an: Mit ihren textilen Arbeiten, Performances, Texten und Installationen reagiert sie auf gegebene Räume und architektonische Strukturen, um sie zu ergänzen, zu verfremden oder zu verdecken. Im Studio, einem Projektraum mit Lichthof im zweiten Stock des Gebäudes, schafft die Künstlerin ein raumgreifendes gestepptes und genähtes Textilwerk. In Referenz auf den Ort bildet sie Elemente des realen Außenraums nach, integriert sie in eine fiktive Landschaftskulisse und schafft eine Umkehrung von Innen und Außen.
Die vierteilige Szenerie aus insgesamt elf Paneelen zeigt eine felsige Meeresküste und eine ländliche Gegend zu vier verschiedenen Tageszeiten, welche in Lichtstimmung und Farbigkeit variiert. Emma LaMortes Bildmotiven liegt eine Faszination für Gotik, Fantasie, Kitsch, Fetisch und Naturromantik zu Grunde. Die Werkserie Aussicht (2020) verzichtet auf das Figurative zugunsten einer allegorischen Landschaftsdarstellung, in der die Position der Betrachter*innen der 360-Grad-Perspektive auf einem Aussichtsturm entspricht. Die Beschäftigung mit der Aussicht – der sehnsuchtsvolle Blick nach draußen in die Ferne oder in die Zukunft – ist ein wiederkehrendes Sujet in Bildender Kunst und Literatur vor allem zur Zeit der deutschen Romantik und ruft unmittelbar die Bildwelt Caspar David Friedrichs wach.
Die auf Keilrahmen gespannten, dem Patchwork entlehnten Collagen entziehen sich einer einfachen Klassifizierung als „Textilkunst“: durch die grobe und improvisierte Verarbeitung, die Vielfalt der Formsprache, Haptik und Motivik sowie die nostalgische Ästhetik erscheinen sie ungewöhnlich raum- und zeitlos, verortet in einer Dichotomie zwischen absoluter Gegenwart und Historizität. Gleichsam zählt das textile Material zu einer Handwerkskunst, die traditionell Frauen zugeordnet ist. In der Auseinandersetzung mit Fragen der Ökonomie beleuchtet Emma LaMorte historisch geprägte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung (emotionale Arbeit, Fürsorge, Haushalt, Mutterschaft auf der einen Seite, Geldarbeit, Karriere, Profilierung und Prestige auf der anderen) sowie die Diskrepanz ihrer jeweiligen Wertigkeit und Anerkennung in der Gesellschaft. In der medialen sowie inhaltlichen Beschäftigung mit tradierten, reaktionären Geschlechterrollen blickt die Künstlerin auf Mechanismen des öffentlichen sowie privaten Raums, die diese festigen und aufrechterhalten: patriarchalische Infrastrukturen, diskriminierende Arbeitsökonomien, struktureller Sexismus und Gewalt.
Zur Ausstellung im Kölnischen Kunstverein ist eine Publikation mit Texten der Künstlerin Rosa Aiello und Werkansichten der gezeigten Arbeiten erschienen (Grafik: Thomas Spallek). Das Medium Text ist integraler Bestandteil Emma LaMortes Praxis und erweitert die szenografische Kulisse aus improvisierter Stepptechnik um Erzählungen. Die Wiederholung der Wandpaneele findet sich als Stilmittel in den Texten Aiellos wieder. Der tageszeitliche Rhythmus und die Abfolge beschreiben eine häusliche Routine, in der Zeitlichkeit variabel ausgedehnt oder verkürzt wird. Emma LaMorte hinterfragt, wie Zivilisation und soziale Strukturen geformt und gestaltet – und wie sie wieder zerstört werden – und erschafft eine Zukunftsvision, die aussichtsreich oder aussichtslos sein kann.
Die Ausstellung wird begleitet von einem Rahmenprogramm aus Lesung, Lecture Performance, Kinderworkshop, Tarot Workshop und einer Radioshow von wechselnden Gästen, unter ihnen die Künstler*innen Rosa Aiello, Bitsy Knox und Benjamin Marvin, die Autorin Jessa Crispin und die Musikerin Laura Sparrow.
Emma LaMorte (*1984 in Victoria B.C., Kanada) lebt und arbeitet in Berlin. Sie erhielt einen Master of Fine Arts am Royal Institute of Art in Stockholm, Schweden. Zuletzt wurden ihre Arbeiten in Einzelpräsentationen in der Galleri Thomassen in Göteborg (2020, zusammen mit Anders Johansson), in der Gärtnergasse in Wien (2019, zusammen mit Benjamin Marvin), bei Stadium (2018) und Ashley (2017), beides in Berlin, sowie im Rahmen von Gruppenausstellungen bei Polansky in Prag (2019), Braunsfelder in Köln (2018), Sm in Marseille (2018), Hotdock in Bratislava (2018), INDUSTRA in Brno (2018) und Decad in Berlin (2018) gezeigt.
Die Ausstellung ist Teil von Kanadas Kulturprogramm als Ehrengast der der Frankfurter Buchmesse 2020. Sie wird unterstützt durch das Canada Council for the Arts und die Regierung von Kanada.
Kuratorin: Miriam Bettin
Mit freundlicher Unterstützung von:


Emma LaMorte, 2020. 
Emma LaMorte: Aussicht, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Emma LaMorte. Foto: Mareike Tocha. 
Emma LaMorte: Aussicht, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Emma LaMorte. Foto: Mareike Tocha. 
Emma LaMorte: Aussicht, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Emma LaMorte. Foto: Mareike Tocha. 
Emma LaMorte: Aussicht, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Emma LaMorte. Foto: Mareike Tocha. 
Emma LaMorte: Aussicht, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Emma LaMorte. Foto: Mareike Tocha. 
Emma LaMorte: Aussicht, 2020. Installationsansicht Kölnischer Kunstverein. Courtesy: Emma LaMorte. Foto: Mareike Tocha.
-
Einzelausstellung: Tony Conrad, 15.2. – 12.7.2020

Eröffnung: Freitag, 14. Februar, 19 Uhr
21 Uhr Filmvorführung Tony Conrad “The Flicker”, 1966, 16mm-Film, s/w, 30 Min.Tony Conrad (1940-2016) ist Experimentalkünstler und gilt als Schlüsselfigur für Medienkünstler wie Tony Oursler oder Mike Kelley. Er war als Violinist einer der Mitbegründer der Minimal Music und zusammen mit La Monte Young und John Cale Pionier von Drone-Musik. Als zentrale Figur der Avantgarde, dessen Karriere sich über sechs Dekaden spannt, strahlt sein Werk über Amerika hinaus und wird mit dieser Ausstellung einem europäischen Publikum nach seiner Teilnahme an der documenta 5 wieder in seiner Vielschichtigkeit vergegenwärtigt werden. Mit seinem ersten Film “The Flicker” (1966) schuf er eine Ikone des strukturellen Films. Seine musikalische Arbeit – in Komposition, Performances, selbst hergestellten Musikinstrumenten – ist unweigerlich mit seinem Werk als bildender Künstler verbunden.
Der Kölnische Kunstverein realisiert diese erste groß angelegte Ausstellung, Performance- und Musikreihe in Deutschland, die Tony Conrads künstlerische Arbeit ehrt. Sie folgt einer Retrospektive, die 2018 und 2019 in der Albright-Knox Gallery, Buffalo, im MIT List Visual Arts Center und Institute of Contemporary Art at the University of Pennsylvania ausgerichtet wurde. Als zentrale Figur der Avantgarde erreichte Conrad nicht nur Anerkennung durch seine Vorreiterrolle mit Beiträgen als Violinist zur Minimalistischen Musik und zum Strukturellem Film in den 1960ern, er war auch tonangebend für die unterschiedlichsten kulturellen Bereiche, Rockmusik und öffentliches Fernsehen mit eingeschlossen. Conrads erster Film “The Flicker” (1966), ein stroboskopisches Experiment, das für seinen Angriff auf das filmische Medium und die Sinne seines Publikums berühmt ist, führte bald zu Projekten, in denen er Film als skulpturales und performatives Material behandelte. In “Sukiyaki Film” (1973) brachte Conrad beispielsweise kurz angebratenen Film auf die Leinwand und in seinen “Yellow Movies” von 1972/73 strich er Papieroberflächen mit billiger Farbe und präsentierte sie als sich langsam verändernde Filme. Er bahnte den Weg für Drone-Musik und beeinflusste die Gründung von Velvet Underground. Conrad war zugleich ein kämpferischer Kritiker der Medien und ihrer Überwachungswerkzeuge. In den achtziger Jahren kritisierten seine ehrgeizigen Filme über Machtverhältnisse in der Armee und in Gefängnissen, was er als aufkommende Kultur der Überwachung, Kontrolle und Eindämmung empfand. Seine kollaborativen Programme, für das öffentliche Fernsehen in den 1990er Jahren geschaffen, machten ihn zu einer einflussreichen Stimme innerhalb der Gesellschaft (ersichtlich in der Installation “Panopticon” von 1988 oder “WiP”, mit Filmen von Tony Oursler und Mike Kelley, 2013). Conrad war Meister des „Crossovers“, der Überbrückung und Verbindung verschiedener Disziplinen, sodass es unmöglich scheint die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Kunst, Film, Musik und Performance in zeitgenössischer Praxis ohne ihn zu denken. Außerdem war er leidenschaftlicher Pädagoge – seine 40jährige Tätigkeit als Professor am Medien-Department in der University in Buffalo provozierten und inspirierten Generationen von Studierenden bis heute.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Sie ist eine Kooperation zwischen Kölnischem Kunstverein, Köln und dem MAMCO, Genf. Sie basiert auf der retrospektiven Ausstellung, die von der Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York 2018/19, organisiert wurde.
Die Ausstellungsarchitektur im Kölnischen Kunstverein entstand in Zusammenarbeit mit Milica Lopicic.
Das wiederverwendbare Stellwandsystem wurde ermöglicht durch die Imhoff Stiftung.


Weiterer Dank an Galerie Buchholz, Berlin/Köln/New York und Greene Naftali, New York.

Tony Conrad, Gate, 2016; Untitled (…), 2009, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Infant Protective Gesture, 1979, Installationsnsicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Infant Protective Gesture, 1979, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Group of 9 collages, 1977, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Group of 5 collages, 1977, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, H, 1965, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Three Loops for Performers and Tape Recorders, November 8-21, 1961, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Loose Connection, 1973/2011; Tiding over till Tomorrow, 1977, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad, Greene Naftali, New York and Albright-Knox Art Gallery, Buffalo/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Loose Connection, 1973/2011; Tiding over till Tomorrow, 1977, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad, Greene Naftali, New York and Albright-Knox Art Gallery, Buffalo/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012; Yellow Movie 12/14-15/27, 1972, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad, Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012; Yellow Movie 12/14-15/27, 1972, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad, Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Fair Ground Electric Horn, 2003; Quartet, 2008; Unprojectable: Projection and Perspective, 2008, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York; Tate Digital (c) Tate London, London 2020, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Invented Acoustical Tools, 1966-2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Double Cuirasse Amplified Wire for two players, 2010, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Yellow Movie (video), 1973, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Yellow Movie (video), 1973, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Yellow Movie (video), 1973, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Tony Conrad: Later Works in Video, 1989-2011, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: Tony Conrad Archives, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, 8 Pickled E.K. 7302-244-0502, 2006, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Waterworks, 1972/2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Deep Fried 7302, 1973; Roast Kalvar, 1974, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Paul Sharits: Prescription and Collapsed Temporality, 1976, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Yellow TV, February 3, 1973, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Tony Conrad painting in Cologne; Untitled, both 2006, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: Private collection Daniel Buchholz & Christopher Müller, Cologne, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, The Flicker, 1966, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: Tony Conrad Archives, Foto: Mareike Tocha Tony Conrad, The Flicker, 1966, Installation view Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: Tony Conrad Archives, Photo: Mareike Tocha 
Tony Conrad, WiP, 2013, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, WiP, 2013, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, WiP, 2013, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, WiP, 2013, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, WiP, 2013, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
ony Conrad, Studio of the Streets, 1991-93/2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Studio of the Streets, 1991-93/2012, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: The Estate of Tony Conrad and Greene Naftali, New York, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Foto: Mareike Tocha 
Tony Conrad, Homework Helpline, 1994-95, Installationsansicht Kölnischer Kunstverein, 2020, Courtesy: Tony Conrad Archives, Foto: Mareike Tocha
-
Ausstellung: Jahresgaben 2019, 7. – 15.12.2019

Künstler*innen: Martin Assig, Olga Balema, Gerry Bibby, Juliette Blightman, Enrico David, Bradley Davies, Simon Denny, Ayşe Erkmen, Michael Krebber, Mischa Kuball, Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo), Morgaine Schäfer, Julia Scher, Gregor Schneider, Evelyn Taocheng Wang, Rachel Whiteread
Bitte beachten Sie, dass die Jahresgaben exklusiv von Mitgliedern des Kölnischen Kunstvereins erworben werden können. Einen Mitgliedsantrag finden Sie hier:
Ausstellung der Jahresgaben: 7. – 15. Dezember 2019
Eröffnung: Freitag, 6. Dezember 2019, 19 UhrWir freuen uns Ihnen neue, eigens für den Kunstverein geschaffene Werke zusammen mit früheren Jahresgaben zu präsentieren, darunter Unikate und limitierte Auflagen. Viele der vertretenen Künstler*innen waren zuletzt mit Arbeiten in der Gruppenausstellung Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstvereins und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf zu sehen. Ebenfalls mit dabei: über den Kunstverein zu erwerbende Editionen des Salon Verlags.
Geänderte Öffnungszeiten während der Jahresgaben-Ausstellung: durchgehend Mo – So von 11 – 18 Uhr, Eintritt frei
-
Ausstellung: Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 1.9. – 24.11.2019


Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019 Mit Maskulinitäten schließen sich der Bonner Kunstverein, der Kölnische Kunstverein und der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf zu einem internationalen Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Publikationsprojekt zusammen, um Konzepte von Maskulinität mit und aus der zeitgenössischen Kunst heraus zu untersuchen. Gemeinsam wird der Frage nachgegangen, wie eine feministische Ausstellung über Männlichkeit aussehen könnte.
Vor dem Hintergrund vorherrschender reaktionärer Manifestationen von Männlichkeit
sowie einer uneingeschränkten Kritik an ihren hegemonialen Ausformungen zielt die Zusammenarbeit darauf ab, patriarchale und heteronormative Geschlechterkonzeptionen zu destabilisieren. Anhand von künstlerischen Produktionen, Performances, Theaterstücken, Lesungen, Vorträgen, Screenings und Workshops werden alternative Handlungsräume aufgeworfen, um performative und transgressive Konzeptionen von Identität, Geschlechtlichkeit, Sexualität und Körper in den Vordergrund zu rücken.Alle drei Kunstvereine haben in der Vergangenheit verschiedene feministische und queere Ausstellungsprojekte präsentiert. Während diese darauf ausgerichtet waren männlich dominierte Repräsentation von Weiblichkeit in Kunst- und Kulturgeschichte aus der Narration einer männlichen Autorschaft zurückzufordern, sind es bei Maskulinitäten wiederum Entwürfe und Konzeptionen des Männlichen, die zur Disposition gestellt werden: die Veränderungen tradierter Ausformungen von Männer- und Körperbildern, damit verbundene Macht- und Sichtbarkeitspolitiken sowie schließlich deren Verhandlung und Dekonstruktion in der Kunst der 1960er Jahre bis heute. Ausgehend von künstlerischen und kunsttheoretischen Perspektiven unterschiedlicher Zeitlichkeiten wird Männlichkeit als einem uneindeutigen, pluralistischen Konzept begegnet, das historisch bedingt, veränderlich und gesellschaftlich konstruiert ist.
Kuratiert von: Eva Birkenstock, Michelle Cotton und Nikola Dietrich.
Künstler*innen der Ausstellung
Vito Acconci, The Agency, Georgia Anderson & David Doherty & Morag Keil & Henry Stringer, Lutz Bacher, Louis Backhouse, Olga Balema, Lynda Benglis, Judith Bernstein, Gerry Bibby, Alexandra Bircken, Juliette Blightman, Patricia L. Boyd, Anders Clausen, Keren Cytter, Enrico David, Vaginal Davis, Jonathas de Andrade, Jimmy DeSana, Nicole Eisenman, Hedi El Kholti, Jana Euler, Hal Fischer, Andrea Fraser, keyon gaskin mit Samiya Bashir, sidony o‘neal und Adee Roberson, Eunice Golden, Philipp Gufler, Richard Hawkins, Jenny Holzer, Hudinilson Jr., Allison Katz, Annette Kennerley, Sister Corita Kent, Mahmoud Khaled, Jürgen Klauke, Jutta Koether, Tetsumi Kudo, Klara Lidén, Hilary Lloyd, Sarah Lucas, Robert Morris, Shahryar Nashat, D’Ette Nogle, Henrik Olesen, D.A. Pennebaker & Chris Hegedus, Josephine Pryde, Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo), Carol Rama, Lorenzo Sandoval, Julia Scher, Agnes Scherer, Bea Schlingelhoff, Heji Shin, Katharina Sieverding, Nancy Spero, Anita Steckel, Evelyn Taocheng Wang, Carrie Mae Weems, Marianne Wex, Martin Wong, Katharina Wulff
Bonner Kunstverein
Lynda Benglis, Judith Bernstein, Alexandra Bircken, Patrica L. Boyd, Jana Euler, Hal Fischer, Eunice Golden, Richard Hawkins, Jenny Holzer, Hudinilson Jr., Allison Katz, Mahmoud Khaled, Hilary Lloyd, Sarah Lucas, Robert Morris, D’Ette Nogle, Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo), Bea Schlingelhoff, Anita SteckelKuratiert von: Michelle Cotton
Kölnischer Kunstverein
Georgia Anderson & David Doherty & Morag Keil & Henry Stringer, Louis Backhouse, Olga Balema, Gerry Bibby, Juliette Blightman, Anders Clausen, Enrico David, Jonathas de Andrade, Jimmy DeSana, Jenny Holzer, Hedi El Kholti, Hilary Lloyd, Sarah Lucas, Shahryar Nashat, Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo), Carol Rama, Bea Schlingelhoff, Heji Shin, Evelyn Taocheng Wang, Carrie Mae Weems, Marianne Wex, Martin Wong, Katharina WulffKuratiert von: Nikola Dietrich
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
Vito Acconci, The Agency, Keren Cytter, Vaginal Davis, Nicole Eisenman, Andrea Fraser, keyon gaskin mit Samiya Bashir, sidony o´neal und Adee Roberson, Philipp Gufler, Jenny Holzer, Annette Kennerley, Sister Corita Kent, Jürgen Klauke, Jutta Koether, Tetsumi Kudo, Klara Lidén, Henrik Olesen, D.A. Pennebaker & Chris Hegedus, Josephine Pryde, Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivio), Lorenzo Sandoval, Julia Scher, Agnes Scherer, Bea Schlingelhoff, Katharina Sieverding, Nancy Spero, Evelyn Taocheng WangKuratiert von: Eva Birkenstock
Programm am Eröffnungswochenende:Eröffnung am Samstag, 31. August 2019
14.30 Uhr Bonner Kunstverein
17.00 Uhr Kölnischer Kunstverein
19.30 Uhr Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, DüsseldorfSamstag, 31. August
Legal Gender, Wiederaufführung der Performance von Anita Steckel
ab 14.30 Uhr, Bonner KunstvereinParallel Lines, Performance von Gerry Bibby mit Ellen Yeon Kim
ab 17 Uhr, Kölnischer KunstvereinNaked Self (Transitioning) (21 Months On Hormone Replacement Therapy)
Nude Performance von Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo)
17.30 – 18.30 Uhr, Kölnischer Kunstverein
20 – 21 Uhr, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, DüsseldorfSonntag, 1. September
Tectonic Mnemonic, eine Plattform für Lesungen mit Gästen, eingeladen von Gerry Bibby
15 Uhr, Kölnischer Kunstverein
Mit freundlicher Unterstützung von:

Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha. 
Maskulinitäten. Eine Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, Ausstellungsansicht Kölnischer Kunstverein, Foto: Mareike Tocha.
-
Einzelausstellung: Jay Chung & Q Takeki Maeda – The Auratic Narrative, 12.4. – 23.6.2019

Eröffnung am 11. April 2019, 19 Uhr
um 21 Uhr Moulting, Diashow mit den Künstlern
Organisiert man eine Ausstellung, die einen Überblick über das Gesamtwerk eines*r Künstler*in geben soll, so geschieht dies üblicherweise in Form einer Geschichte. Diese Geschichte enthält für gewöhnlich die Geburt der Künstlerin („Geboren im ländlichen Rumänien“), einen richtungsweisenden Moment in ihrer Karriere („Sie zog dann nach Paris, wo sie ihre philosophischen Studien an der Sorbonne fortsetzte“), und eine Phase des Strebens nach künstlerischem, kulturellem oder politischem Erfolg („Diese Identitäten prägen seine Arbeit seit über 30 Jahren“i). Diese Berichte von individueller Entwicklung sind – wenn auch sachlich korrekt – konstruiert, oder genauer gesagt: werden von Kunstfachleuten fabriziert und aufrechterhalten. In einem Interview über die gesellschaftlichen Auswirkungen von quantitativen Metriken spielt der Soziologe Steffen Mau auf diese Praxis an, indem er darlegt, dass „fiktionale Erwartungen“ für Künstler*innen „hauptsächlich über eine Story im Stile einer auratischen, in der Zukunft eintretenden Erfolgsgeschichte“ hergestellt werden. Er fährt fort:[So] wird man in der jeweiligen Künstlerpersönlichkeit etwas sehen, was noch vollkommen vage und spekulativ ist, aber in Zukunft dazu führen kann, dass sie eine bestimmte Marktposition und eine bestimmte Bewertung am Markt erfahren wird. Es geht um eine dynamische Aufwärtsbewegung von Reputation, eine Positivvision. Das Erzählen dieser Storys bedarf nach wie vor der Expertenkultur, also professioneller Kritiker/innen, Kunstvermarkter/innen oder -vermittler/innen und Berater/innen.ii
Maus Einschätzung ist angelehnt an die Arbeit des Soziologen Olav Velthuis, dessen Buch Talking Prices eine Studie der Prinzipien zur Bepreisung zeitgenössischer Kunst darstellt. Laut Velthuis sind es Narrative archetypischer Art (z.B. Tragödie, Erfolgsgeschichte, Bildungsroman), die – im Gegensatz zu ökonomischen Gesetzen wie Angebot und Nachfrage – die Kunstmarktpreise bestimmen. Thema dieser Geschichten sind sowohl Individuen als auch Entwicklungen in dem Bereich als Ganzem. Wie Mau hebt auch Velthuis hervor, dass diese Narrative kollektiv von Menschen, die mit Kunst arbeiten, erzählt und nacherzählt werden, wobei er zugleich ihren fiktiven Charakter betont. Er schreibt: „Es geht nicht darum, ob dieses Narrativ bzw. die, die folgen werden, wahrheitsgetreu in Bezug auf die historische Wirklichkeit sind oder nicht. Im Grunde muss ihr Wahrheitsgehalt als zumindest fragwürdig eingestuft werden.“iii
Solche Narrative tragen zur immateriellen Qualität von Einzigartigkeit und Authentizität bei, die sowohl in Kunstwerken als auch bei Künstlerpersönlichkeiten wahrgenommen wird, der „Aura“, so der von dem Literaturkritiker Walter Benjamin geprägte Begriff. Die Erfahrung dieses Phänomens, abstrakt und ungreifbar per Definition, ist aufgeladen mit Widersprüchen und Zweideutigkeit. Beispielsweise wird einerseits weithin akzeptiert, dass zeitgenössische Kunst ein gänzlich professionalisiertes Feld ist, auf dem das Kunstschaffen, ebenso wie eine Reihe damit verbundener Beschäftigungen zu dem Zweck unternommen werden, spezifische begleitende Ergebnisse zu erreichen. Andererseits wird auch angenommen – aber selten offen ausgesprochen –, dass Visionen vom aktuellen oder zukünftigen Stellenwert eines*r Künstler*in noch nicht oder niemals wahr werden könnten (wie die Formulierung „fiktionale Erwartungen“ iv andeutet).
Gleichermaßen werden die charakteristischen Qualitäten der Arbeit und Biographie eines*r Künstler*in als Produkt nur eines einzigen Individuums gesehen, während selten anerkannt wird, dass sie in Wirklichkeit dem Objekt oder Individuum zuteilwerden und in diesem Sinne der kollektive Ausdruck der gemeinsamen Ansichten, Werte und gelebten Erfahrungen der diskursiven Kunst-Welt sind.Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.

The Auratic Narrative, eine Ausstellung mit Arbeiten von Jay Chung und Q Takeki Maeda, läuft vom 12. April bis zum 23. Juni 2019.
i Alle Zitate in Klammern entstammen Ausstellungsbeschreibungen auf der Website des MoMA, Museum of Modern Art, New York, https://www.moma.org, Stand März 2019.
ii Steffen Mau und Uwe Vormbusch, „Likes statt Leistung. Ein Gespräch zwischen Uwe Vormbusch und Steffen Mau über die fortschreitende Quantifizierung des Sozialen.“ Texte zur Kunst 110 (Juni 2018), https://www.textezurkunst.de/110/likes-and-performance.
iii Olav Velthuis, Talking Prices, Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art (Princeton University Press, 2005), 145.
iv Siehe auch Jens Beckert, Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016), 93: „Die Fiktionalität von literarischen Texten wir darüber hinaus offen kommuniziert, während sie im Falle fiktionaler Erwartungen verborgen bleibt.“
Mit freundlicher Unterstützung von:
Weiterer Dank an Gaga, Mexiko-Stadt und Los Angeles; ESSEX STREET, New York; Galerie Francesca Pia, Zürich; Cabinet Gallery, London; Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Wir danken auch Frau Lauffs-Wegner für Ihre Unterstützung des Künstlerbuches Letters, das zur Ausstellung erschienen ist.
Weitere Information werden regelmäßig über unseren Newsletter bekannt gegeben.
Programm:11. April 2019, 21 Uhr
Moulting (2019), Diashow mit Jay Chung und Q Takeki Maeda14. Mai 2019, 11 – 18 Uhr
Moulting (2019), Diashow von Jay Chung und Q Takeki Maeda28. Mai 2019, 19 Uhr
Show and Tell # 1
Scalalogia and The Wheel of Life (2019), Book Launch mit Jasmin Werner und einem Vortrag von Philipp Kleinmichel zusammen mit einem Konzert von pogendroblemShow and Tell ist eine fortlaufende, vom Ausstellungsprogramm unabhängige Veranstaltungsreihe mit verschiedenen Formaten. Eingeladen werden wechselnde Gäste, darunter Künstler*innen, Autor*innen und Musiker*innen.
6. Juni, 2019, 19 Uhr
Letters (2019) und Jay Chung and Q Takeki Maeda x Teruo Nishiyama (2017), Double Book Launch mit Jay Chung und Q Takeki Maeda19. Juni 2019, 19 Uhr
Vorführung eines Films der Regisseure Lev Kalman und Whitney HornFührungen am Donnerstag durch die Ausstellung
25. April 2019, 17 Uhr mit Miriam Bettin
23. Mai 2019, 17 Uhr mit Lukas Flygare (in englischer Sprache)
6. Juni 2019, 17 Uhr mit Nikola DietrichFührungen am Sonntag durch die Ausstellung
19. Mai 2019, 15 Uhr mit Jasmin Werner
23. Juni 2019, 15 Uhr mit Jasmin Werner
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Maeda, Ohne Titel, 2014 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jay Chung & Q Takeki Maeda: Untitled, 2018 Foto: Mareike Tocha 
Jay Chung & Q Takeki Meada, The Auratic Narrative, Kölnischer Kunstverein 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel -
Ausstellung: Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, 16.2. – 1.3.2019

Eröffnung am 15. Februar 2019, 19 Uhr
Führungen
Donnerstag, 21. Februar, 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit Juliane Duft
Donnerstag, 7. März, 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit Nikola Dietrich
Donnerstag, 21. März, 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit Miriam Bettin
Eine Ausstellung in Kollaboration mit Marte Eknæs und Nicolau VergueiroPower of Print ist eine Übersichtsschau des richtungsweisenden Schaffens und Lebens der verstorbenen brasilianischen Art-Direktorin und Designerin Bea Feitler (1938–1982).
Die Ausstellung umfasst Zeitschriften, Bücher, Videodokumentationen und Reproduktionen aus Feitlers kometenhafter Karriere, aus den 1950er Jahren bis zu ihrem Tod, sowie persönliche Fotos und Arbeiten, die ihr Leben und das ihrer Freund*innen, Mitstreiter*innen und Kolleg*innen dokumentieren. Feitler, die insbesondere für ihre Tätigkeit bei Harper’s Bazaar, Ms., Rolling Stone und der modernen Vanity Fair bekannt ist, hat das Erscheinungsbild des amerikanischen Grafikdesigns nachhaltig geprägt, indem sie einen gänzlich neuen Ansatz hinsichtlich der Wirkung von Magazinen verfolgte.
Feitlers gestalterische Freiheit, die sich in der Verschiebung gewöhnlicher Standards hin zu einem weiblichen Blick manifestierte, gestattete es ihr, die kommerzielle Darstellung von Frauen neu zu verhandeln und das Magazin als Massenmedium zu nutzen, um mittels einer dynamischen Ästhetik auf gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen. Power of Print bündelt einige der wiederkehrenden Motive ihres Schaffens, darunter die menschliche Silhouette, den Mittelfalz als kompositorisches Element, die Collagetechnik, der innovative Einsatz von Typografie, das Verfahren von Solarisationund Duplexdruck, mittels derer sie das Verhältnis zwischen Körper, Text und Grafikdesign sowohl unter gestalterischen als auch sensorischen Gesichtspunkten neu dachte. „Ein Magazin sollte dynamisch sein. Es sollte Rhythmus haben. Man kann eine Seite nie für sich allein betrachten – man muss visualisieren, was davor und danach kommt.“
Bea Feitler wurde in Rio de Janeiro geboren, nachdem ihre jüdischen Eltern aus Nazideutschland geflohen waren. Sie zog nach New York, um an der Parsons School of Design zu studieren und kehrte 1959 vorübergehend nach Brasilien zurück, wo sie Poster, Titelseiten und Doppelseiten für Bücher und die progressive Literaturzeitschrift Senhor gestaltete.
1961 zog Feitler zurück nach New York und wurde kurz darauf, im Alter von 25 Jahren, zusammen mit Ruth Ansel zur Co-Art-Direktorin von Harper’s Bazaar ernannt, wo sie gemeinsam das Erbe ihrer Mentoren Alexey Brodovitch und Marvin Israel antraten. Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit für das Magazin trugen sie maßgeblich zur Entstehung einer neuen feministischen Redaktionssprache mit Anklängen an die Populärkultur bei. In Einklang mit den politischen und kulturellen Umwälzungen der 1960er Jahre, verfassten sie einige der einprägsamsten Editorials der Dekade. Feitler und Ansel waren ihrer Zeit weit voraus: gemeinsam mit Richard Avedon arbeiteten sie 1965 für das Fotoshooting eines bedeutenden Magazins als erste mit einem schwarzen Modell, und noch im gleichen Jahr wurde ihnen, ebenfalls gemeinsam mit Avedon, die ADC-Medaille für das Space Helmet-Cover der Aprilausgabe von Harper’s Bazaar verliehen. Während ihrer Zeit bei dem Magazin konnte Feitler enge Beziehungen zu Fotograf*innen aufbauen, die sie bis zum Ende ihrer Karriere begleiteten – zu ihrem engsten Freundeskreis zählten unter anderem Avedon, Bill King und Diane Arbus. Ihre Rolle als Schlüsselfigur der Szene wird in Power of Print durch eine Sammlung von Kunstwerken, persönlichen Fotografien, Postkarten und Briefen von Mitstreiter*innen und Freund*innen wie Andy Warhol, Annie Leibovitz, Jacques-Henri Lartigue, Ray Johnson, Tomi Ungerer, Candy Darling und Gloria Steinem nachgezeichnet. Ihre von Natur aus kollaborative Arbeitsweise erhob das kommerzielle Editorial zu einer Kunstform.
1972 schloss sich Feitler mit Gloria Steinem zusammen, um das feministische Magazin Ms. zu gründen. Durch den Einsatz von Leuchtfarben und Kompositionen, in denen sie Fotografie, Illustration und Typografie vermischte, belebte sie den Inhalt des Magazins auf zugleich ansprechende und kritische Weise. Kontoversen Botschaften verlieh ihr meisterliches Design zusätzlichen Nachdruck, während feministische Themen in den Mainstream eingehen konnten. Bei Ms. konnte Feitler frei über die visuellen Inhalte bestimmen – eine Freiheit, die ihre Karriere beflügelte. Auch heute noch ist das Magazin relevant, seiner Zeit voraus und ein Paradebeispiel für Feitlers eindrucksvolle, einflussreiche und unverwechselbare Ästhetik.
Zwischen 1974 und 1980 gestaltete Feitler einige wegweisende Bücher, darunter The Beatles, Henri-Jacques Lartigues The Diary of a Century, Helmut Newtons White Women und Vogue: Book of Fashion Photography. Ihrer Überzeugung folgend, dass sich in einem modernen Buch Bild- und Wortgehalt die Waage halten sollten, handelte sie aus, dass sie neben den Autor*innen und/oder Fotograf*innen namentlich für die Gestaltung der Buch-Cover genannt werden und ein Honorar erhalten sollte. Darüber hinaus fungierte sie als leitende Grafikerin für Werbekampagnen von Calvin Klein, Halston, Max Factor, Diane Von Furstenberg, u.a., gestaltete Plattencover wie das des berühmten Rolling Stones-Albums Black and Blue und entwarf Poster und Kostüme für das legendäre Alvin Ailey American Dance Theater.
1975 begann Feitler, auf Drängen Annie Leibovitz’ hin, für Rolling Stone zu arbeiten. Während ihrer sechsjährigen Zusammenarbeit mit dem Magazin gestaltete sie dessen Format zweimal um. Feitlers letztes Projekt war die Gesamtkonzeption der wiederbelebten Vanity Fair, deren Premierenausgabe sie zudem gestaltete.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Sie wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Bruno Feitler. Andere Ausstellungen zu dem Werk von Bea Feitler wurden außerdem bei Between Bridges in Berlin und UKS in Oslo gezeigt, beide 2017, und ko-kuratiert von Marte Eknæs and Nicolau Vergueiro. Wir danken Between Bridges für die großzügige Bereitstellung einer Vielzahl an Leihgaben und Eugen Ivan Bergmann für seinen Beitrag zum Ausstellungsdesign. Des Weiteren danken wir The Andy Warhol Museum, Pittsburgh für seine Leihgabe, sowie The New School Archives & Special Collections, New York, und dem Alvin Ailey American Dance Theater, New York für die Bereitstellung von zusätzlichem Material.

Mit freundlicher Unterstützung von:
Weitere Information werden regelmäßig über unseren Newsletter bekannt gegeben.

Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Power of Print – The Work and Life of Bea Feitler, Kölnischer Kunstverein, 2019, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Jahresgaben 2018, 19.12. – 20.7.2018

-
Ausstellung: Cut-Up und Wolfgang Tillmans, 23.11. – 19.12.2018

Eröffnung am 22. November 2018, 19 Uhr
Cut-Up ist ein vierwöchiges Programm von Ausstellungen, Vorträgen, Musik, Performances, Screenings und einer Magazin-Präsentation. KünstlerInnen, MusikerInnen, Autoren, Verleger und ein internationaler Projektraum wurden eingeladen, den Kunstverein mit seinen unterschiedlichen Räumlichkeiten von Ausstellungshalle, Kino, Theatersaal und Studio mit einem aktiven und vielseitigen Programm zu beleben. Die Methode des Cut-Up bezeichnet eine von Brion Gysin und William S. Burroughs ins Leben gerufene Collage-Strategie des Zerschneidens und Neu-Arrangierens, um Texte, Bilder oder Sound von der ihnen zugewiesenen Bedeutung herauszulösen und sie einer anderen, variierenden (Bedeutungs-) Ebene zuzuführen. Die eingeladenen Gäste beziehen sich in unterschiedlicher Weise auf dieses Verfahren. So kann ein Format im Charakter einer „lebendigen Gesamtstruktur“ entstehen, das nicht statisch verweilt, sondern imstande ist, sich kontinuierlich zu verändern und im Wissen um die Vorläufigkeit das Gefühl des Moments verstärkt. So entsteht ein Ort des Zusammenspiels von regionaler und internationaler Interaktion und jede Präsentation befördert vielfältige Kollaborationen, Hybridisierungen und Performativität.
Mit den Teilnehmenden:
Michael Amstad, Marie Angeletti, Bonnie Camplin, Eric D. Clark, Kerstin Cmelka, Marte Eknæs, Helene Hegemann, Karl Holmqvist, Ellen Yeon Kim, Mario Mentrup, Luzie Meyer, Johanna Odersky, Deborah Schamoni, Mark von Schlegell, Starship, Rirkrit Tiravanija, Nicolau Vergueiro, Adrian WilliamsSorry I’m Late. XOXO Echo
Der Einladung des Kölnischen Kunstvereins folgend, organisiert der ehemals in Zürich ansässige Kunstraum Taylor Macklin eine Ausstellung zur Beschaffenheit und Interpretation von Räumen und deren Bedingungen.
Mit: Der Alltag (Sensationen des Gewöhnlichen), Andrea Büttner, Nicolas Buzzi, Brice Dellsperger, Maya Deren, Ayasha Guerin, Eva Meyer & Eran Schaerf, Carissa Rodriguez, Ben Rosenthal & Flavio Merlo, Li Tavor, Miriam Yammad, Constantina ZavitsanosWolfgang Tillmans
Anlässlich der Gestaltung der Vereinsgabe 2018 richtet Wolfgang Tillmans eine Art Playback-Room in unserem Studio ein, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, seine Musik von der Langspielplatte zu hören. Für seine Vereinsgabe räumte er seinem fortwährenden Interesse an Musik einen Platz ein und produzierte eine Schallplatte, sowie Cover und Innentasche. Entstanden ist ein „Kehrschaufel“-Konzert für die A-Seite und eine Musik-Collage von selbst mitgeschnittenen Radio-Aufnahmen aus den 80er-und 90er-Jahren, außerdem ein eigener Song „The Future is Unwritten“ von 1985 für die B-Seite. 2014 konzipierte Tillmans bereits die dreiteilige Ausstellungsreihe Playback-Room in seinem non-profit Ausstellungsraum Between Bridges, den er im selben Jahr in Berlin wiedereröffnete, nachdem er seit 2006 in London beheimatet war. 2016 wurden Playback-Rooms im Lenbachhaus in München und 2017 innerhalb einer Einzelausstellung von Wolfgang Tillmans in der Tate Modern eingerichtet.Kuratiert von Nikola Dietrich
Veranstaltungen
22. November 2018
19 Uhr
Eröffnung der Ausstellung mit Einführung von Nikola Dietrich23. November 2018
15 bis 17 Uhr
Politics and Space Workshop mit Ayasha Guerin
organisiert von Taylor Macklin
(in englischer Sprache)
19 Uhr
Filmscreening: Rirkrit Tiravanija, Karl’s Perfect Day, 2017, 94 min
Lesung von Karl Holmqvist und Artist Talk mit Nikola Dietrich
(in englischer Sprache)30. November 2018
19 Uhr
Eröffnung der Jahresgaben-Ausstellung 2018
21 Uhr
Radio Play und Performance: Ellen Yeon Kim & Mark von Schlegell,
MUFA (Museum of Unfinished Art), 40 min4. Dezember 2018
19 Uhr
Im Trailerpark der Angreifbaren: Ein Sideshow-Varieté zu dem Film Die Angreifbaren (Release Anfang 2019)
mit Kerstin Cmelka & Mario Mentrup.
Gäste: Rainer Knepperges und Sven Heuchert7. Dezember 2018
19 Uhr
Lesung und Filmscreening: Helene Hegemann & Deborah Schamoni13. Dezember 2018
19 Uhr
Filmscreenings:
Marte Eknaes & Michael Amstad, A People Mover Evening
& Artist Talk mit Nikola Dietrich (in englischer Sprache)16. Dezember 2018
19 Uhr
Magazin-Launch: 20 Jahre Starship, Berlin, 18. Ausgabe
Filmscreening und Talk mit Bonnie Camplin;
Record Release Musix’ lost its colour mit Eric D. Clark19. Dezember 2018
19 Uhr
Filmscreening: Luzie Meyer, The Flute, 2018
Ausstellung und Performance: Johanna Odersky,
organisiert von Juliane Duft






-
Einzelausstellung: Julien Ceccaldi – Solito, 8.9. – 11.11.2018

Ausstellungseröffnung am Freitag, 7.9.2018, 18.00 Uhr
Lesung aus dem Comicbuch Solito von Julien Ceccaldi (in englischer Sprache), 21.00 Uhr
mit anschließenden Snacks und Drinks in Kollaboration mit Okey Dokey IIIn der ersten umfassenden Ausstellung Solito von Julien Ceccaldi, die in einer zweimonatigen Vorbereitung vor Ort im Kölnischen Kunstverein produziert wurde, entspinnt sich ein Märchen um die gleichnamige Hauptfigur – einem lüsternen, jungenhaften 30-jährigen Mann, der es unerträglich findet, noch Jungfrau zu sein und gewillt ist, sich jedem hinzugeben. Der Plot ist inspiriert von bekannten Erzählungen, so beispielsweise von Die Schöne und das Biest, Blaubart oder Nussknacker und Mausekönig, in denen sich die Protagonistinnen am Ende in den hässlichen Mann verlieben und sich Sexualität durch Macht und Gewalt manifestiert. Das Einzige wiederum, was Solito von der unansehnlichen, schnell beendeten Liebe bleibt, ist ein kurzes Souvenir des Glücks, das schnell verblasst.
Das Elend wird in dem von Ceccaldi im Rahmen der Ausstellung publizierten Comicbuch noch umso augenscheinlicher geschildert. Was als ein Traum über sein eigenes unfähiges Handeln interpretiert werden kann, geht die titelgebende Figur Solito darin so weit, sich mit dem Tod selbst einzulassen. Er folgt Oscar, einem Soldaten, der, aus einer mystischen Welt kommend, nicht viel mehr ist als „ein Kadaver, eine leere Schale, auf den sich seine Fantasien stürzen“ (J. Ceccaldi). Solito wird seltsam ambivalent dargestellt: Verzweifelt auf der Suche nach Partnerschaft und Geborgenheit, agiert er zugleich masochistisch, in dem er seine wahre Bestimmung, nämlich für immer zurückgewiesen zu werden, selbst orchestriert. Er spielt mit dem Tod wie man mit Puppen spielen würde, und träumt von ewiglich andauernden Kaffeekränzchen in Gesellschaft von Skeletten, während er sich zur gleichen Zeit unterbewusst wünscht, dass sie sich gegen ihn wenden. Indem er ihr Vertrauen missbraucht, wird er am Ende unweigerlich in die reale Welt auf einen Bürgersteig zurückgeworfen – ein Verweis auf die Geschichte Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans-Christian Andersen, einer der wohl prominentesten Märchenschreiber.
Als direkte Vorlage für Solitos Charakterzüge dienen Ceccaldi denn auch intime Details über dessen Leben, nach denen bekannt ist, dass Andersen keinerlei sexuelle Beziehungen zu Frauen oder zu Männern unterhielt und sich stattdessen nach jeder Begegnung intensiver Selbstbefriedigung hingab. Beschrieben als kindlich und liebestoll, galt er innerhalb der Kopenhagener Elite des 19. Jahrhunderts als Außenseiter und Alleingänger, so dass er am Ende seiner Tage alleine und einsam starb. Seine Original-Märchen waren pervers und morbide; seine leidenden Heldinnen starben oft eines qualvollen Todes. Spätere Adaptionen seiner eher tragischen Geschichten, die meist ohne Happy End ausgingen, wurden später umgeschrieben.
Weitere ästhetische sowie konzeptuelle Bezüge lassen sich vor allem in der Animationserie Die Revolution des Mädchens Utena (1997) von Kunihiko Ikuhara und den Manga The Rose of Versailles (1972) oder Oniisama E (1975) von Riyoko Ikeda finden, in denen Symbole des Märchens, Androgynität und unausweichliche Schicksale mit modernen Kontexten und zeitgenössischen thematischen Auseinandersetzungen kombiniert werden. Die Ausstellung übernimmt von diesen Werken auch den freizügigen Umgang, Mythen von verschiedenen Orten und über verschiedene Epochen hinweg, vom Mittelalter, zum 19. Jahrhundert, bis in unsere Zeit, miteinander zu verweben.
Diese Ausgangspunkte bilden den referentiellen Rahmen für die im Comic Solito etablierten Figuren und ihr Umfeld, die innerhalb und außerhalb der Ausstellungsräume auf verschiedene Oberflächen transferiert sind: als animierte Videoloops, Skulpturen, digitale Zeichnungen oder als Malereien auf Plastik. Anders als noch auf den Buchseiten folgen die Werke in der Ausstellung keiner konstanten linearen Narration mehr. Inspiriert von der Cel-Art, einer Technik, die für Animationsfilme genutzt wurde, um Hintergründe von den Vordergründen losgelöst zu zeichnen, entstehen Bilder unterschiedlicher Stimmungen durch Überlagerungen, Verschiebungen oder Trompe-l’œil-Effekte. Sie zirkulieren um die Figur Solito herum, der sich die Besucher in der Ausstellungshalle mit ihrer eigenen Körperhaftigkeit annähern. In einer Art kaleidoskopischer Fragmentierung, in der sich dieselbe Figur, oder Aspekte derselben in kleinen Variationen wiederholen – ähnlich wie sich auch Identität aus vielen Einzelteilen zusammensetzt -, ist sie imstande Gefühle von Eitelkeit, Leid und Beengtheit, aber auch Momente emanzipatorischer Befreiung hervorzurufen.Die Ausstellung wurde kuratiert von Nikola Dietrich.
Zur Ausstellung ist das Comicbuch Solito von Julien Ceccaldi erschienen. (36 Seiten, hrsg. von Nikola Dietrich, September 2018). Es kann für € 12 (Mitglieder € 8 ) erworben werden.
Julien Ceccaldi wurde 1987 in Montreal, Kanada, geboren und lebt in New York. Einzelausstellungen umfassen u.a. Human Furniture, Beach Office, Berlin (2017); Gay, Lomex, New York, NY (2017), und King and Slave, Jenny’s, Los Angeles, CA. Er nahm in jüngerer Zeit an Gruppenausstellungen teil wie z.B. Painting Now and Forever 3, Greene Naftali, New York, NY; An Assembly of Shapes, Oakville Galleries, Ontario, Canada; oder The Present in Drag, 9th Berlin Biennale for Contemporary Art, Berlin.
Mit freundlicher Unterstützung von

Weiterer Dank an Gaga, Mexico City / Los Angeles & Jenny’s, Los Angeles
Veranstaltungsprogramm:
SEPTEMBER
Fr 7.9., 21 Uhr
Lesung aus dem Comicbuch Solito
von Julien Ceccaldi (in Engl.)Sa 8.9., 16 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Juliane DuftSo 9.9., 19 Uhr
Artist Talk mit Julien Ceccaldi
mit der Präsentation von japanischen Animationsfilmen (in Engl.)Do 13.9., 17 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Jasmin WernerDo 20.9., 17 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Nikola DietrichDo 20.9., 18 Uhr
Film im Kino
Kunihiko Ikuhara, La Fillette Revolutionnaire Utena, 1999 (OmU, dt. UT)Di 25.9., 18 Uhr
Film im Kino
Catherine Breillat, Barbe Bleue, 2009 (OmU, engl. UT)So 30.9., 15 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Jasmin WernerOKTOBER
Do 11.10., 17 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Juliane DuftDo 11.10., 18 Uhr
Film im Kino
Catherine Breillat, La Belle Endormie, 2011 (OmU, engl. UT)Do 18.10., 18 Uhr
Film im Kino
Mori Masaki, The Door into Summer, 1975 (OmU, engl. UT)So 21.10., 15 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Jasmin WernerDo 25.10., 17 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Jasmin WernerDo 25.10., 18 Uhr
Film im Kino
Catherine Breillat, 36 Fillette, 1988 (OmU, engl. UT)NOVEMBER
Sa 3.11., 18 Uhr – 2 Uhr
Museumsnacht 2018
Führungen durch die Ausstellung und SOLITO BAR:
Anime-Filmscreenings, Karaoke & japanische Snacks
in Zusammenarbeit mit dem Bistro Kombu (Düsseldorf-Benrath)Mi 7.11., 17 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit Nikola DietrichMi 7.11., 18 Uhr
Film im Kino
Chantal Akerman, Golden Eighties, 1986 (35mm-Film, OmU, dt. UT)
mit einer Einführung von Juliane DuftMit freundlicher Unterstützung des Filmclub 813

Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Julien Ceccaldi, Solito, Kölnischer Kunstverein, 2018, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel. -
Einzelausstellung: Alex Da Corte – THE SUPƎRMAN, 20.4. – 17.6.2018

Das künstlerische Schaffen von Alex Da Corte, geboren 1980 in der US-amerikanischen Stadt Camden, umfasst Malereien, Skulpturen, Installationen sowie Filme, anhand derer er die Bedingungen sowie die Verworrenheit menschlicher Wahrnehmung und die damit verbundenen Reaktionen untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Komplexität der heutigen Konsumwelt und deren Verflechtungen mit sozialen, kulturellen und politischen Sphären. So lassen sich in seinem Werk die Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten wie Begehren, Hoffnung oder Sehnsucht genauso ausmachen, wie mit den Termini Abhängigkeit, Entfremdung oder Verlorenheit. Ausgangspunkt seiner Hervorbringungen sind zumeist Objekte und Szenerien aus seinem persönlichen wie auch aus dem allgemeineren gesellschaftlichen Umfeld, die er durch Modifikationen, Perspektivwechsel oder kontrastreiche Gegenüberstellungen in Kunstwerke transformiert, die kraftvoll an alle Sinne appelliert.
Im Zentrum der Präsentation von Alex Da Corte stehen vier filmische Arbeiten, die in der großen Halle des Kölnischen Kunstvereins zu einer eindringlichen Installation verquickt sind. Dabei handelt es sich bei den Filmen um das 2013 entstandene Werk TRUƎ LIFƎ sowie um die 2017 realisierte, dreiteilige Arbeit BAD LAND. Trotz der unterschiedlichen Entstehungsjahre haben beide Formulierungen denselben Ausgangspunkt, der eng mit einer persönlichen Erfahrung des Künstlers verbunden ist. So wurde ihm vor einigen Jahren von einem Freund ein Foto zugesandt, das ihn angeblich vor Leonardo da Vincis Mona Lisa im Pariser Musee du Louvre zeigen sollte, obwohl die Aufnahme in Wirklichkeit den US-amerikanischen Rapper Eminem festhielt. Diese, durch eine gewisse Ähnlichkeit begründete Verwechslung bewog Alex Da Corte dazu, sich mit dem weltbekannten Musiker und mit dessen Alter Ego Slim Shady auseinanderzusetzen, der in der Vergangenheit immer wieder dafür in der Kritik stand, Gewalt zu verherrlichen und schwulen- sowie frauenfeindlich zu sein. Ihn interessierte die Frage, was Eminem als Person ausmacht, welche Psychologie sich mit ihr verbindet und wie sie sich wohl in einem privaten Umfeld gebärden würde. Seine Beschäftigung mündete schließlich in der Arbeit TRUƎ LIFƎ, für die er in die Rolle des Rappers schlüpfte, indem er sich die Haare blond färbte, entsprechende Kleidungsstücke anzog und dessen Habitus annahm. Bezugnehmend auf die Dokumentation 66 Scenes From America des dänischen Filmemachers Jørgen Leth, in welcher der Pop-Art-Künstler Andy Warhol einen Hamburger isst, zeigt TRUƎ LIFƎ den von Alex Da Corte gespielten Eminem beim Verzehr von Frühstückscerealien der in Nordamerika weitverbreiteten Marke life. Die Einfachheit, die die dargebotene Szene trotz aller kompositorischer Raffinesse aufweist und die die simplen Handlungen von Künstlern wie Bas Jan Ader, Gilbert & George oder Bruce Nauman ins Gedächtnis ruft, steht im Gegensatz zu dem Glanz und Ruhm sowie dem Drang und der Drastik, die der Rapper verkörpert. Eminem wird von Alex Da Corte mehr als Mensch, denn als unerreichbare und unbesiegbare Berühmtheit dargestellt, wobei durch die beiläufige, aber dennoch spürbare Platzierung einer Packung Cinnamon Life mit dem Werbebild eines afro-amerikanischem Jungen als lockender Blickfang erweiternd auch soziopolitische Aspekte spürbar werden.
Die drei Bad Land-Filme, die Alex Da Corte als zusammenhängendes Werk konzipiert hat und die mit ihrem Titel auf das als Badlands bekannte Problemviertel in Philadelphia verweist, in dem sich das Atelier des Künstlers befindet, führen die in TRUƎ LIFƎ thematisierten Gedanken weiter fort. Der erste Film zeigt den Musiker in einem in zwei Bereiche untergliederten Setting, das mit seinen klaren, einheitlichen Rot- und Gelbtönen an eine poppige Variante von Ellsworth Kelly oder Blinky Palermo denken lässt. In der knapp elfminütigen Sequenz ist der Protagonist damit beschäftigt einen chaotischen Haufen von älteren laystation-Controllern zu entknoten, um sie sodann vor sich auf einem tischartigen Unterbau ordentlich aufzureihen. Für Alex Da Corte fungiert die gezeigte Handlung als Sinnbild für Angst, Macht und Kontrolle, wobei durch die Banalität der Szene erneut mit dem generellen Bild von Eminem gebrochen wird.
Der zweite Film der Bad Land-Serie verweist demgegenüber wesentlich deutlicher auf die Gepflogenheiten eines Rappers. So zeigen die von atmosphärischen Klängen untermalten Bilder, wie der Musiker mit selbstgebauten Pfeifen und Wasserpfeifen Cannabis raucht. Hierbei überrascht, wie perfekt, künstlerisch und humorvoll die Rauchinstrumente aus unterschiedlichen Alltagsgegenständen gestaltet sind, ohne an Funktionstüchtigkeit einzubüßen. Im Zuge des Konsums scheint der Raucher insofern dann auch in einen tranceartigen Zustand zu verfallen, der von einem tiefen Lachen und intensivem Husten begleitet wird, was auf einen Mangel an Routine zurückzuführen zu sein scheint.
Der dritte und letzte Film der Bad Land-Folge, zeigt den Rapper schließlich bei der wohl ungewöhnlichsten Handlung. Vor einem grauen Hintergrund und begleitet von nicht eindeutig zuordenbaren Geräuschen und Tönen, ist der gespielte Eminem damit beschäftigt, zunächst seine Haare mit hellgelbem Senf einzufärben, indem er sie damit beschmiert. Im weiteren Verlauf des Films setzt er sich dann eine aus Papier gefertigte Krone eines Schnellrestaurants auf, die immer und imme wieder mit der Würzpaste eingerieben wird, obwohl sie bereits deutliche Spuren der Bearbeitung zeigt. Das für Macht stehende Symbol, das sich insbesondere in der Hip-Hop-Kultur großer Beliebtheit erfreut, wird somit nicht nur mit den Auswüchsen der Konsumgesellschaft in Verbindung gebracht, sondern ebenfalls mit spürbarem Witz in Frage gestellt. Dass der Rapper zum Ende der Sequenz mehr und mehr den Verstand zu verlieren scheint, kann in diesem Zusammenhang kaum verwundern, verbinden sich doch mit einem Herrschaftssymbol wie einer Krone doch immer auch die Angst, Macht zu verlieren, während Fast-Food-Ketten nicht selten für verführerische Illusionen stehen.
Die Auseinandersetzung mit psychologischen Parametern, wie sie sich sowohl in den Bad Land-Filmen als auch in TRUƎ LIFƎ offenbart, repräsentiert eine nicht unwesentliche Triebkraft für das Schaffen von Alex Da Corte, in dem sich die herkömmlichen Grenzen zwischen den verschiedenen Gattungen aufzulösen scheinen. Sie lässt sich nicht zuletzt auch an der Ausstellung THE SUPƎRMAN nachvollziehen, in deren Rahmen die Filme in eine komplexe Architektur eingebettet sind, die mit einer bemerkenswerten Intensität mit der Wahrnehmung und den Emotionen des Rezipienten spielt. So wird man nicht nur von der skulpturalen Präsenz der Filme, sondern ebenfalls von der malerischen Wirkung der Einbauten überwältigt, die irgendwo zwischen Pop Art und Surrealismus zu einem berauschenden Gesamtkunstwerk verschmelzen, das Erinnerung an Albträume genauso wachruft wie an Disneyland.Alex Da Corte hatte unter anderem Einzelausstellungen im New Museum in New York (2017), in der Secession in Wien (2017), im Massachusetts Museum of Contemporary Art, North Adams (2017), im Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (2015) sowie im Institute for Contemporary Art in Philadelphia (2015). Zudem war er an Gruppenausstellungen im Whitney Museum of American Art in New York (2017), im Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk (2016) sowie an der Biennale in Lyon (2015) beteiligt.

-
Einzelausstellung: Walter Price – Pearl Lines, 20.4. – 17.6.2018

Walter Price wurde 1989 in Macon, im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia geboren und lebt heute in der multikulturellen Weltstadt New York. Das mehrheitlich kleinformatige Werk des Künstlers lässt sich in Gemälde und Zeichnungen untergliedern, in denen er sich mit persönlichen Emotionen und Erfahrungen, gesellschaftlichen Konventionen sowie historischen Entwicklungen auseinandersetzt. Seine visuellen Formulierungen zeigen in der Regel Innen- oder Außenräume, die von Objekten, Lebewesen, Zeichen, Symbolen und Formen besetzt sind. So finden sich in den Arbeiten Verweise auf Gliedmaßen, Figuren, Palmen, Hüte, Sofas, Pissoirs und Autos genauso wie die Umrisse von Architekturen oder Vegetation. Dabei sind diese Bildelemente, die sich mal mehr und mal weniger deutlich dechiffrieren lassen, nicht immer in eine klare Beziehung zueinander gebracht, so dass eine Form von Narration zwar spürbar, aber nicht fassbar wird. Dieser Umstand wird nicht zuletzt auch dadurch unterstützt, dass der Amerikaner in seinen Kompositionen auf herkömmliche Ordnungsmuster verzichtet, Hierarchien unterwandert und Perspektiven aufhebt, was den Malereien und Zeichnungen eine ungewöhnliche Anmutung verleiht, die gelegentlich auf die schöne Einfachheit sowie den Purismus von Bildern von Kindern verweist.
Gelegentlich lassen sich in den Werken von Price ebenfalls Buchstaben und Schriftzüge ausmachen, wobei diese Setzungen zumeist nur angeschnitten oder teilweise verdeckt sichtbar sind, so dass sie nicht auf eine unmittelbare Lesbarkeit angelegt zu sein scheinen und eher wie das Echo eines verbalisierten Gedankens daherkommen. Als weiteres Merkmal vieler Arbeiten von Price kann deren intensive Farbigkeit angesehen werden, die auf einen virtuosen Umgang mit der Palette zurückzuführen ist. Zudem kennzeichnet eine große Zahl der Formulierungen ein erhöhtes Interesse für die Materialität der verwendeten Werkstoffe, was sich sowohl an einem stark gestischen und damit haptisch spürbaren Farbauftrag sowie an der Sichtbarlassung der Mal- und Zeichengründe nachvollziehen lässt. Dabei kann in der starken, expressiven Farbigkeit, wie auch in dem spezifischen Umgang mit den Arbeitsmitteln ein bewusste Auseinandersetzung mit den Vertretern der klassischen Moderne in Europa, wie auch mit den Spätausläufern der US-amerikanischen Nachkriegskunst gesehen werden, wobei der Künstler trotz aller Bezugnahmen mit Souveränität eine eigene Sprache formuliert.
Im Rahmen der Ausstellung im Kölnischen Kunstverein soll das Schaffen von Price erstmals umfassender in Deutschland vorgestellt und gewürdigt werden. Dabei sollen sowohl ältere als auch neuere Werke in den Fokus rücken, die durch ortsspezifische Wandmalereien und -zeichnungen eine Ergänzung finden. Zudem soll das Schaffen durch einen umfassenden, zweisprachigen Katalog erläutert werden, der die Präsentation in Köln begleitet und dokumentiert.
Gefördert von:

-
Einzelausstellung: Talia Chetrit – Showcaller, 17.2. – 25.3.2018

Das fotografische Werk von Talia Chetrit, die 1982 in Washington D.C. geboren wurde, zeichnet sich durch eine bemerkenswerte kompositorische Raffinesse und visuelle Kraft aus, die mit einer stringenten Programmatik einhergeht. Ihr Schaffen umfasst Selbstbildnisse, Portraits von Familienmitgliedern, Liebhabern und Freunden, Akte, Stillleben sowie Stadtlandschaften, die in unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder bewusst gewählte Bezüge zur Kunstgeschichte erkennen lassen. Zudem selektiert die Künstlerin gelegentlich Aufnahmen aus einem Fundus, der während ihrer Jugend entstand, und überführt diese Relikte früherer Zeiten im Zuge von Bearbeitungsprozessen in ihre heutige Praxis.
Unabhängig von dem jeweiligen Sujet und von den Vorgehensweisen bei der Bildgenese, liegt ein wesentliches Augenmerk ihres Interesses auf der Erforschung und Offenlegung der gesellschaftlichen, konzeptuellen sowie technischen Rahmenbedingungen der Gattung Fotografie. Dabei ist ihre Arbeit von dem Bestreben durchdrungen, die physischen und historischen Beschränkungen der Kamera zu kontrollieren, ihr manipulatives Potential mitzudenken und das Verhältnis von Fotograf und Motiv zu hinterfragen.Die Ausstellung Showcaller, die Chetrit eigens für den Kölnischen Kunstverein konzipiert hat, umfasst eine Gruppe von mehrheitlich neuen und überarbeiteten Werken, welche die Grundgedanken ihrer Praxis exemplarisch vor Augen führen. So beinhaltet die Präsentation eine umfangreiche Serie von unbetitelten Fotografien, die unterschiedlich bevölkerte und belebte Straßen der Weltstadt New York zeigt. Durch die starke Beschneidung der Motive und die sichtbare Körnung der vergrößerten Bilder, werden Stadt und Menschen zu einem unbekannten, abstrahierten und fremd wirkenden Geflecht von Körpern, dem die Künstlerin ihre eigenen, manipulierten Erzählungen auftragen kann. Dieser Umstand wird nicht zuletzt dadurch beflügelt, dass Chetrit die Aufnahmen aus größerer Entfernung durch die Fenstergläser verschiedener Gebäude anfertigte und dabei, trotz aller Fokussierung, in einer Distanz verharrt.
Im Rahmen der Ausstellung stehen dieser Werkfolge Fotografien gegenüber, die eine stark konträre Inhaltlichkeit vermitteln und durch die unübersehbare Offenbarung privater Momente von einer ausgeprägten Nähe und Intimität durchdrungen sind. So zeigt ein großformatiges Diptychon die Künstlerin mit ihrem Lebensgefährten beim Liebesspiel, wobei sich keiner der beiden Akteure, die vor dem Hintergrund einer blühenden Landschaft gezeigt sind, dem strengen Blick der Kamera bewusst zu sein scheint. Dabei ist man als Betrachter durch das gewundene Kabel des Fernauslösers mit der Szene derart verbunden, dass wir einmal mehr an unseren Anteil an der Konstruktion von Bildern erinnert werden.Talia Chetrit wurde 1982 in Washington D.C. geboren und lebt heute in New York. In der jüngeren Vergangenheit war sie u.a. an Einzel- und Gruppenausstellungen im Whitney Museum of American Art in New York (2016), Art Gallery of Ontario in Toronto (2016), im LAXART in Los Angeles (2014), im Palais de Tokyo in Paris (2013), im Studio Voltaire in London (2013) und im SculptureCenter in New York (2012) beteiligt. 2018 wird sie im Rahmen einer Präsentation im MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo in Rom erstmals einer breiteren Öffentlichkeit in Italien vorgestellt.
Gefördert von:

Das Ausstellungsprojekt wird mit großem Engagement begleitet und unterstützt von
Andra Lauffs-Wegner & KAT_A -
Einzelausstellung: Adriano Costa – wetANDsomeOLDstuff VANDALIZEDbyTHEartist, 17.2. – 25.3.2018


Adriano Costa, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung wetANDsomeOLDstuff VANDALIZEDbyTHEartist im Kölnischen Kunstverein 2018 Innerhalb eines Zeitraums von annähernd zehn Jahren hat Adriano Costa ein Werk geschaffen, das eine Brücke zwischen der südamerikanischen und europäischen Kunst schlägt, künstlerische Bewegungen wie den Neoconcretismo oder die Arte Povera aktualisiert und ihnen eine neue Dimension verleiht. Auf Basis von vorgefundenen Materialien und Objekten des Alltags fertigt der 1975 geborene Brasilianer Assemblagen, Skulpturen, Malereien und Filme, die er in seinen Ausstellungen zu raumgreifenden Installationen derart zusammenschließt, dass sich bühnenartige Szenerien ergeben, die mit „Environments“ verglichen werden können. Dabei sind die Arbeiten zumeist Resultat umfassender und zeitintensiver Recherchen, die Costa an seinen jeweiligen Aufenthaltsorten betreibt. So durchstreift er gleich einem neugierigen und aufgeschlossenen Tourist seine verschiedenen Forschungsgebiete, wobei er neben den bekannten Hauptwegen, insbesondere den weniger im Fokus stehenden oder übersehenen Pfaden innerhalb der urbanen, aber auch ländlichen Kontexten folgt. Sein Interesse gilt ethnologischen, soziologischen und historischen Entwicklungen und Phänomenen, die er zum Gegenstand seiner Werke macht, ohne allerdings die präzisen Praktiken eines Wissenschaftlers anzuwenden. Für Costa fungieren die unterschiedlichen Themen und Fragestellungen gewissermaßen als Vehikel für seine poetischen und nicht selten humorvollen Formulierungen, die er aus den Fundstücken, Mitbringseln und Objekten der jeweiligen Streifzüge und Untersuchungen bildet.
Zur Vorbereitung der Ausstellung im Kölnischen Kunstverein hielt sich Costa für einen längeren Zeitraum im Rheinland auf, um die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen wie auch die städtebaulichen und landschaftlichen Zusammenhänge zu erkunden und zu erforschen. Im Rahmen der Präsentation stehen insofern weniger ältere, als neuere Werke im Vordergrund, die in den verschiedenen Räumlichkeiten der Institution – der zentralen Ausstellungshalle, dem Kabinett im Untergeschoss sowie im Kino – zu einer ortsspezifischen Installation verquickt sind. Dabei verbindet sich mit dem ausgesproch facettenreichen Projekt das Bestreben, Parallelen wie auch Gegensätze zwischen der europäischen und südamerikanischen Gesellschaft herauszuarbeiten, um das Bewusstsein für das Leben in einer globalisierten Welt zu schärfen.Gefördert von:

Das Ausstellungsprojekt wird mit großem Engagement begleitet und unterstützt von
Andra Lauffs-Wegner & KAT_A
-
Einzelausstellung: Cameron Jamie – Bodies, Faces, Heads, 21.10. – 10.12.2017

Auftakt der Ausstellung: Freitag, 20.10.2017, 18–20 Uhr
Mit Bodies, Faces, Heads präsentiert der Kölnische Kunstverein die erste institutionelle Einzelausstellung von Cameron Jamie in Deutschland. Das Werk des 1969 in Los Angeles geborenen Künstlers, der heute in Paris lebt, ist über einen Zeitraum von gut 25 Jahren entstanden und von enormer medialer Vielfalt: Es umfasst Holzskulpturen, Keramiken, Zeichnungen, druckgrafische Arbeiten, Fotografien, Filme, Künstlerbücher sowie musikalische Produktionen.
Eines seiner zentralen Themen ist Identität als existenzielle Grundlage des Individuums, die durch soziale und anti-soziale Codes erzeugt wird. Jamies Blick auf randständige Realitäten und magisch-obskure Rituale, die die verdeckte Seite unserer Gesellschaft verkörpern, ist analytisch und immersiv zugleich: Jamie ist teils selbst geprägt von den Subkulturen, die er künstlerisch transformiert. Dabei ist sein Schaffensprozess alles andere als wissenschaftlich oder kühl kalkuliert – Jamie folgt einer spontanen, psychologisch inspirierten Formfindung, deren Ergebnis zutiefst persönlich ist und zugleich eine archaische, urtümliche Atmosphäre freisetzt. Statt um konkrete Bedeutungszusammenhänge geht es um Zustände des Seins und des Bewusstseins.
Im Kölnischen Kunstverein werden fünf Werkgruppen von 2008 bis 2017 vorgestellt, die das Thema Körper und Natur umkreisen. Die Gruppe Smiling Disease (2008) besteht aus großformatigen Holzmasken, wie sie in der österreichischen Alpenregion Bad Gastein Tradition sind – Jamie fertigte sie gemeinsam mit einem professionellen Holzschnitzer an, der seine Zeichnungen re-interpretierte und ihnen einen groteskes, deformiertes Antlitz verlieh. Im zweiten Raum sind Keramiken der auf Metallsockeln ausgestellt: vom Künstler handgearbeitete, geisterhafte Körper, die im dritten Raum mit organisch fließenden Sockelformen verwachsen. Die direkte, kraftvolle Bearbeitung des Tons, die pulsierende Formenvielfalt der Figuren und die aufwändigen Glasuren lassen die Figuren wie fremde Wesen im Raum ein Eigenleben führen.
An den Wänden hängen eine Serie von Keramikmasken, die sich mit ihrer Innenseite als eigentümliche, hohle Gesichter präsentieren, sowie Monotypien, die eine Vielfalt von floralen und figürlichen Assoziationen auslösen. Jede Papierarbeit ist ein Unikat und birgt mehrere Schichten von Zeichnungen und Farben – ein Merkmal, das Jamies Schaffensprozess generell widerspiegelt: Ausradieren, Überschreiben, Zerstören und Wiederansetzen sind elementare Grundzüge, der jeder seiner Arbeiten innewohnen.
Cameron Jamie hatte u.a. Einzelausstellungen in der Kunsthalle Zürich in Zürich (2013), im Hammer Museum in Los Angeles (2010), im Musée des Beaux-Arts in Nantes (2009) sowie im Walker Art Center in Minneapolis (2006). Darüber hinaus war er an Gruppenausstellungen, wie “The Absent Museum” Wiels – Centre d’Art Contemporain in Brüssel (2017), der Biennale von Lyon (2015), der Berlin Biennale (2010 und 2008) sowie der Biennale von Venedig (2005) beteiligt. Im Kölnischen Kunstverein wurden Werke des Amerikaners erstmals im Rahmen der Ausstellung “Keine Donau: Cameron Jamie, Peter Kogler, Kurt Kren” präsentiert (2006). Ab dem 17. November zeigt er eine Einzelausstellung in dem Düsseldorfer Projektraum CAPRI.
Gefördert vom

Das Ausstellungsprojekt wird mit großem Engagement begleitet und unterstützt von
Andra Lauffs-Wegner & KAT_A -
Einzelausstellung: Sam Anderson – Big Bird, 1.7. – 10.9.2017

Die 1982 in Los Angeles geborene Künstlerin Sam Anderson hat in der jüngeren Vergangenheit ein Werk entwickelt, anhand dessen sie – ausgehend von ihrer eigenen Biographie und den Geschichten ihres sozialen Umfeldes – die existenziellen Bedingungen des menschlichen Lebens erforscht. Der Schwerpunkt ihrer Praxis liegt auf Skulpturen und Installationen, wobei sie in regelmäßigen Abständen ebenfalls Filme realisiert. Dabei reichen die Arbeiten der mittlerweile in New York lebenden Künstlerin von narrativen Bildschöpfungen, bis hin zu nur schwerlich lesbaren und daher abstrakt anmutenden Formulierungen. So treffen in dem Schaffen von Anderson aus Epoxid-Ton geformte Figuren, wie etwa ein kniendes Mädchen, ein Reiter oder eine Fischerin, auf ephemere Materialcollagen, für die sie unterschiedliche, teilweise vorgefundene Stoffe und Objekte, wie Puzzleteile, Federn, Hölzer, Blumen oder Gräser, als Grundlage nutzt und diese nach bestimmten, aber nicht immer ergründbaren Kriterien strukturiert. Zwischen diesen beiden Extrema – den eindeutig auf Narration angelegten Plastiken und den kaum deutbaren Arrangements – sind Skelette von Tieren anzusiedeln, die ebenfalls zu ihrem Repertoire gehören und eine andere Dimension der Realität in ihr Schaffen übertragen.
Unabhängig von der formalen Erscheinung der Skulpturen muss dem Verhältnis der Objekte zum Raum eine besondere Bedeutung beigemessen werden. Die Arbeiten sind darauf angelegt mit Proportionen zu spielen, wobei die umgebende Architektur als Maßstab fungiert. In diesem Zusammenhang erfährt jegliche Form von Monumentalität eine Negation, was nicht zuletzt auch durch die Fragilität vieler Werke unterstrichen wird. Für den Rezipienten bedeutet dieser Umstand eine kontinuierliche Vogelperspektive auf die Arbeiten, die Anderson in ihren Präsentationen zu komplexen Installationen verbindet. Durch das Zusammenspiel der Werke verhalten sich die Präsentationen der Amerikanerin wie inszenierte Landschaften. Gerade durch die Kombination und Verquickung der verschiedenartigen Werke evoziert sie besondere Wechselwirkungen und Spannungsverhältnisse, die den Arbeiten und Arrangements Leben einhauchen und einen erheblichen Anteil an ihrer faszinierenden Wirkung haben. Die Künstlerin erschafft Szenarien, die nicht nur genauso lebensnah wie lebensfremd erscheinen, sondern auch eine Erweiterung des Möglichkeitsspektrums der Skulptur bedeuten.
Ein ähnliches Potenzial verbindet sich ebenfalls mit dem Filmen von Anderson, die erneut die Auseinandersetzung mit den Techniken der Collage erkennen lassen und für die sie eigene oder gefundene Aufnahmen, untermalt von Musik und Sprache, zu neuen Erzählungen zusammenfügt. Auch in diesen Werken werden traumartige Szenarien entworfen, die allerdings, im Gegensatz zu den Skulpturen und Installationen, noch wesentlich stärker im Hier und Jetzt verankert sind.
Die Einmaligkeit ihres Schaffens hat Anderson in den letzten Jahren ein beachtliches Renommee eingebracht, sodass sie bereits einige wichtige Ausstellungsbeteiligungen verzeichnen kann. So hatte die Künstlerin Einzelpräsentationen im Rowhouse Project in Baltimore (2016), bei Tanya Leighton in Berlin (2015), bei Mother´s Tankstation in Dublin (2015), bei Between Arrival and Departure in Düsseldorf (2015) sowie bei Off Vendome in Düsseldorf (2014). Darüber hinaus war sie an Gruppenausstellungen, wie „ICHTS“ im Dortmunder Kunstverein (2016) oder „Greater New York“ im MoMA PS1 (2015) beteiligt.
Für den Kölnischen Kunstverein hat Anderson eine komplexe Werkschau konzipiert, die sowohl ältere als auch neue Arbeiten umfasst, um auf diese Weise einen weiterreichenden Einblick in ihre Praxis zu ermöglichen. Neben der zentralen Ausstellungshalle sowie dem Kino werden ebenfalls die angrenzenden Kabinette des Kölnischen Kunstvereins genutzt, sodass ein Parcours durch die unterschiedlichen Erzählungen und Formulierungen von Sam Anderson möglich wird.
Anlässlich der Ausstellung, die in Kooperation mit dem SculptureCenter in New York ausgerichtet wird, erscheint der erste Katalog der Künstlerin sowie eine unikatäre Edition.
Das Projekt wird von der Kunststiftung NRW sowie von der Leinemann Stiftung gefördert.


Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Sam Anderson, Big Bird, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Avery Singer – Sailor, 27.4. – 11.6.2017


Avery Singer, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung Sailor im Kölnischen Kunstverein 2017, Foto: David Lieske Avery Singer, geboren 1987 in New York, hat in der jüngeren Vergangenheit ein Werk geprägt, das zu den kraftvollsten Beiträgen zur jüngeren Kunstgeschichte gezählt werden kann und der Gattung Malerei – gerade vor dem Hintergrund der sich wandelnden technischen Rahmenbedingungen – neue Impulse liefert. So produziert die Künstlerin anhand von 3D-Programmen wie SketchUp oder Blender virtuelle Bildwelten, die sich in ihrer formalen Erscheinung als einfache Animationen lesen lassen und damit unmittelbar auf ihren Ursprung verweisen. Diese Bildschöpfung überträgt Singer mittels einer Airbrush-Pistole auf zumeist großformatige Leinwände, sodass jegliche Form von Handschrift negiert wird. Das Resultat dieser Vorgehensweise sind visuelle Formulierungen, die stilistisch auf den französischen Kubismus sowie die Grisaillemalerei verweisen und somit in gewisser Hinsicht eine anachronistische Ästhetik zu proklamieren scheinen.
Auf inhaltlicher Ebene thematisiert Singer gesellschaftspolitische Fragestellungen, wobei sie nicht selten auf humorvolle Weise insbesondere die Regeln und Rituale der Kunstszene in den Fokus rückt. So beschäftigt sie sich etwa mit dem Ablauf eines Atelierbesuches, der Rolle des Künstlers oder Direktors als Animateur, dem Dasein einer Muse oder dem Bild des Mäzens. Immer wieder finden sich in den Bildern von Singer zudem Anspielungen auf die großen Meister der Kunstgeschichte, durch die nicht zuletzt auch die konzeptuellen Aspekte ihres Schaffens eine Betonung erfahren.
Dank der Einzigartigkeit ihres künstlerischen Schaffens war Avery Singer in den letzten Jahren bereits an zahlreichen internationalen Ausstellungen beteiligt: sie hatte Einzelpräsentationen in der Kunsthalle Zürich, im Hammer Museum in Los Angeles sowie im Stedelijk Museum in Amsterdam. Im Rahmen der Ausstellung im Kölnischen Kunstverein, die anlässlich der ArtCologne 2017, soll die Arbeitsweise der Künstlerin erstmals einem breiteren Publikum in Deutschland vorgestellt werden. Dabei umfasst die Ausstellung neben figurativen Kompositionen ebenfalls eine neue Werkgruppe, die stilistisch mit ihren bisherigen Arbeiten bricht und anhand derer Singer das weite Feld der Abstraktion erkundet.Mit freundlicher Unterstützung durch:


Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Avery Singer, Sailor, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Danny McDonald – The Beads & Other Objects, 27.4. – 11.6.2017

Danny McDonald, geboren 1971 in Los Angeles, wurde als Mitglied des legendären Art Clubs 2000 bekannt, bei dem es sich um ein Künstlerkollektiv handelte, das 1992 von dem nicht minder geschichtsträchtigen New Yorker Galeristen Colin de Land begründet wurde und zu dem sieben Studenten von The Cooper Union School of Arts zählten. Im Rahmen ihrer Arbeit, die Fotografien, Installationen, Texte und Performances umfasste, untersuchte die Gruppe Phänomene wie die Gentrifizierung des urbanen Kontextes, die Strategien des Kunstmarktes oder die Psychologie der Modebranche. Dabei manifestierte sich in ihren Konzepten und Hervorbringungen ein grundlegendes Interesse für Institutionskritik, die nicht zuletzt als Reaktion auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer Generation zurückzuführen war.
Das künstlerische Werk, das McDonald losgelöst von seinen Aktivitäten als Mitglied des Art Clubs 2000 entwickelt, ist geprägt von den Erfahrungen, die er während der 1990er Jahre sammelte, wobei sein heutiges Schaffen nicht nur eine andere Erscheinungsform aufweist, sondern ebenfalls eine neue Dimension beschreibt. McDonalds Praxis umfasst insbesondere Skulpturen und Filme, die sich gegenseitig ergänzen und befruchten und die sich im gegenwärtigen Kunstkontext durch eine große Souveränität auszeichnen. Für seine haptisch fassbaren Werke nutzt er überwiegend Spielzeugfiguren, gelegentlich allerdings auch andere Alltagsgegenstände, die er nach den Prinzipien der Assemblage-Technik derart miteinander verbindet, dass sich neue Sinnzusammenhänge und bislang nicht dagewesene Erzählungen ergeben. Das Bizarre und Skurrile, das den Arrangements aufgrund der Widersprüchlichkeit der verwendeten Objekte oftmals innewohnt, kann als eines der spezifischen Charakteristika der Skulpturen des Künstlers angesehen werden. An ihnen lässt sich das Bestreben nachvollziehen, mit ausgeprägtem Scharfsinn und Humor, einen Zerrspiegel vor gesellschaftliche wie auch soziopolitische Situationen zu setzen. In eine ähnliche Richtung weisen die filmischen Werke von McDonald, die in der Regel eine starke visuelle wie auch auditive Kraft aufweisen. Für diese Arbeiten bedient sich der Künstler verschiedener Alter Egos, die als Protagonisten der Filme in Erscheinung treten und durch surreal anmutenden Narrationen führen.
Die Ausstellung The Beads & Other Objects, die im Kölnischen Kunstverein anlässlich der ArtCologne 2017 ausgerichtet wird, ist die erste Einzelpräsentation von Danny McDonald in einer europäischen Institution.

Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel 
Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel 
Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel 
Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel 
Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel 
Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel 
Danny McDonald, The Beads & Other Objects, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto. Simon Vogel
-
Ausstellung: ars viva 2017 – Jan Paul Evers, Leon Kahane & Jumana Manna, 11.2. – 26.3.2017

In diesem Jahr geht der ars viva-Preis für Bildende Kunst des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft an Jan Paul Evers (*1982), Leon Kahane (*1985) und Jumana Manna (*1987). Der Preis ist mit zwei Ausstellungen in namhaften Kunstinstitutionen in Deutschland sowie einer Künstlerresidenz auf Fogo Island (Kanada) verbunden. Die Künstler erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 5.000 Euro, darüber hinaus erscheint eine Künstleredition und ein zweisprachiger Katalog im Verlag Sternberg Press.
Der ars viva-Preis wird jährlich an junge, in Deutschland lebende Künstler vergeben, deren Arbeiten sich durch hohe künstlerische Qualität mit richtungsweisenden Positionen auszeichnen. In diesem Jahr wählte die Jury aus 51 vorgeschlagenen Künstlern zehn Finalisten aus, die ihre Arbeiten in ihren Ateliers und den KW Institute for Contemporary Art in Berlin präsentierten. Als ars viva-Preisträger 2017 wurden Jan Paul Evers, Leon Kahane und Jumana Manna gekürt.
Jan Paul Evers arbeitet mit analogen Produktions- und Bearbeitungsprozessen der Fotografie. Aus bestehendem und selbst fotografiertem Material entstehen mithilfe verschiedener Entwicklungstechniken neue Arbeiten. Zentrale Bezugspunkte in Leon Kahanes Videoarbeiten, Fotografien und Installationen sind Themen wie Migration und Identität und die Auseinandersetzung mit Mehr- und Minderheiten in einer globalisierten Gesellschaft. Die Videoarbeiten und Skulpturen von Jumana Manna thematisieren sozialpolitische Fragestellungen, Machstrukturen sowie die Konstruktion von Identität.
Mit freundlicher Unterstützung durch:

Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jumana Manna, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leon Kahane, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Jan Paul Evers, ars viva, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installation view, photo: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Leidy Churchman – Free Delivery, 11.2. – 26.3.2017


Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel Der Künstler Leidy Churchman beschäftigt sich mit der Frage, wie in der heutigen Zeit, in der visuelle Stimuli eine Omnipräsenz aufweisen, Bilder wahrgenommen und verarbeitet werden. In diesem Zusammenhang fertigt Churchman, der 1979 in Villanova in dem US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania geboren wurde, Malereien, die auf bereits existierenden Bildern vom „außergewöhnlichen Schrottplatz“ an visuellen Formulierungen basieren. So malt er die Werke anderer Künstler nach, nutzt Logos, Buchcover oder Werbeanzeigen als Vorlage oder nimmt auf fernöstliche Religionen oder folkloristische Kunst Bezug. Der Bilderkosmos, mit dem man in den Präsentationen von Churchman konfrontiert wird, wirkt daher oft vertraut, auch wenn sich die Gemälde in mehr oder minder großer Ausprägung von ihren Vorlagen unterscheiden.
Für seine Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein, bei der es sich um seine erste institutionelle Präsentation in Europa handelt, hat Churchman eine neue Werkgruppe produziert, die auf den ersten Blick eine irritierende Heterogenität aufweist. So sticht in der Schau zunächst das großformatige Gemälde Standoff ins Auge, das zwei sich kreuzende Giraffen in hohem Gras zeigt. Während dieses Bild einigermaßen klar lesbar zu sein scheint, weist ein kleinformatiges Landschaftsbild mit dem Titel Faultless Aspect eher surreale Züge auf: erleuchtet von einem mächtigen Vollmond, ist auf einer tiefgrünen Wiese eine Art Netz ausgebreitet, das in Kombination mit zwei weißen Kopfkissen und einem Nachttisch zu einem Bett wird. Das Gemälde Peacocking, das von zwei rot-schwarzen, organisch anmutenden Formen sowie unzähligen, haptisch spürbaren Punkten dominiert wird, lässt keine eindeutige Erzählung erkennen und verweist auf das Feld der Abstraktion. Das Bild The Kitchen Sink wiederum, auf dem vor einem tiefblauen Hintergrund in weißen Buchstaben The Laundry Room lesbar ist, scheint die unmittelbare Übertragung eines Hinweisschildes in das Medium Malerei zu sein. Das Gemälde Mahakala nimmt demgegenüber auf die gleichnamige buddhistische Gottheit Bezug, wobei sich Churchman in dem Werk auf dessen signifikanten Mund beschränkt und diesen derart in eine grün-bläuliche Farb- und Formenkomposition einbindet, dass man den Eindruck hat, die Körperöffnung durch ein eigenartiges Guckloch zu erblicken. Die Verbindung zwischen all diesen unterschiedlichen Werken ist die gemeinsame, kaum noch erfassbare Welt, aus der Churchman Bilder wählt, um sie dem Betrachter mit einem anderem Tempo, Gefühl und Bewusstsein vor Augen zu führen. Dabei erschöpfen sich die visuellen Formulierungen des New Yorkers nicht in dem bloßem Transfer in die Gattung Malerei. Mit den Werken Churchmans verbindet sich ein nicht erklärbarer, geheimnisvoller Zauber, dem man sich nur schwerlich entziehen kann.
Leidy Churchman lebt und arbeitet in New York. In der jüngeren Vergangenheit war er an viel diskutierten Themenausstellungen wie etwa Painting 2.0: Malerei im Informationszeitalter im Museum Brandhorst in München (2015) sowie im mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (2016) beteiligt. Zudem präsentierte er in den letzten Jahren Werke im Whitney Museum of American Art in New York (2016), in der Kunsthalle Bern (2015), in der National Gallery of Denmark in Kopenhagen (2014) sowie im MoMA/P.S.1 in New York (2010). Im Jahr 2013 hatte Churchman eine Einzelausstellung in der Boston University Art Gallery, anlässlich derer die erste Monographie über sein künstlerisches Schaffen entstand.
Mit freundlicher Unterstützung durch:


Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Leidy Churchman, Free Delivery, Kölnischer Kunstverein, 2017, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Christiana Soulou – Sonnet to the Nile, 28.10. – 18.12.2016

Mit Sonnet to the Nile präsentiert der Kölnische Kunstverein die erste institutionelle Einzelausstellung von Christiana Soulou in Deutschland. Seit den frühen 1980er Jahren arbeitet die Künstlerin an einem zeichnerischen Werk, das zu den bemerkenswertesten Formulierungen im Bereich der Gattung gezählt werden kann. Im Zentrum des Schaffens der 1961 geborenen Athenerin stehen menschliche und tierische Wesen, die ohne Kontext, ohne Bezug zu einem Ort oder einer Zeit auf dem Papier in Erscheinung treten. Dabei sind die Zeichnungen derart zurückgenommen, dass sie sich nur im Zuge einer eingängigeren Betrachtung wahrnehmen lassen. Mehrheitlich sind die Schöpfungen Soulous monochrom – in Grau-, Blau- oder Rottönen – gehalten und nur gelegentlich sind ergänzende Kolorierungen auszumachen. Insgesamt bestechen die Arbeiten Soulous durch eine Feinheit und Präzision, die für altmeisterliche Zeichnungen und Stiche charakteristisch sind und die im heutigen Kunstgeschehen eine Rarität darstellen. In diesem Zusammenhang gilt es hervorzuheben, dass jede Linie, die Soulou mittels Blei-, Buntstift oder Aquarell zu Papier bringt, nicht nur als Resultat außergewöhnlicher handwerklicher Fähigkeiten angesehen werden kann; so ist es viel entscheidender, dass die Künstlerin selbst die geringfügigste Setzung mit hoher Intensität durchlebt, sich also in das darzustellende Wesen mit großem emphatischen Vermögen einfühlt. Die Linien sind insofern unmittelbarer Ausdruck physischer und psychischer Verfassungen, sodass die Erforschung der Bedingungen des Lebens als wesentliches Thema des Schaffens von Soulou angesehen werden kann.
mit freundlicher Unterstützung durch:


Christiana Soulou, Sonnet To The Nile, Kölnischer Kunstverein 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Christiana Soulou, Sonnet To The Nile, Kölnischer Kunstverein 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Christiana Soulou, Sonnet To The Nile, Kölnischer Kunstverein 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Christiana Soulou, Sonnet To The Nile, Kölnischer Kunstverein 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Christiana Soulou, Sonnet To The Nile, Kölnischer Kunstverein 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Christiana Soulou, The Emperor!, 2012, Kölnischer Kunstverein 2016 
Christiana Soulou, In The Prison With The Birds, 1982, Kölnischer Kunstverein 2016
-
Einzelausstellung: Catharine Czudej – SHHHHH, 9.7. – 4.9.2016

Mit SHHHHH präsentiert der Kölnische Kunstverein die erste Einzelausstellung von Catharine Czudej in Deutschland. Das Werk der 1985 in Johannesburg geborenen und heute in New York lebenden Künstlerin umfasst Skulpturen, Installationen, Malereien sowie Filme und reflektiert die Beschäftigung mit Situationen des Alltags, historischen Entwicklungen sowie gesellschaftlichen Modellen. Dabei kennzeichnet ihr Schaffen zumeist ein humorvoller Umgang mit den verschiedenen Themenbereichen, der sich in einer poppigen, bisweilen überraschend absurden Erscheinung der Werke manifestiert: Ein Gegenstand oder ein Phänomen setzt freie Assoziationsketten in Gang, über die der Ausgangspunkt ihrer Arbeiten im Zuge des Gestaltungsprozesses verfremdet wird.
Für ihre Ausstellung hat Czudej in der zentralen Halle des Kölnischen Kunstvereins ältere und neuere Arbeiten zu einem “Environment” zusammengestellt, das in vielen Facetten auf eine Wohnung verweist und damit Pop Art-Künstler wie etwa Claes Oldenburg ins Gedächtnis ruft. So finden sich in dem Raum diverse Stühle, ein Sofa, verschiedene Lampen, ein Spielzimmer mit überdimensionalen Schachfiguren sowie Utensilien eines Badezimmers. Die häuslichen Gegenstände können das Versprechen ihres Gebrauchswerts allerdings nicht halten: Leuchten und Sitzgelegenheiten sind aus Brezeln und Bierflaschen gebildet, während die aus bizarren Stoffen geformte Couch mit einer Wand verschmilzt und das Badinventar einem improvisierten Künstlerlaboratorium gleicht. Anhand der Objekte inszeniert Czudej skurrile Verformungen von Realität, die Fragen nach dem Potenzial der Imagination genauso aufwerfen, wie nach den Modi der Wahrnehmung.
Ergänzt wird die Zusammenstellung durch ein Labyrinth aus Absperrbändern, das dem Wohnbereich vorgelagert ist und das als Readymade im Kontrast zu den sonstigen Arbeiten in der großen Halle steht. Czudej hat die Barrieren derart im Raum platziert, dass sie einerseits eine expressive Zeichnung im Raum formen und andererseits die herkömmliche Logik von Begrenzungs- und Leitsystemen ad absurdum führen. Für die Künstlerin hat das Labyrinth in seiner spezifischen Aufstellung den Charakter eines Spielfeldes, das von dem Besucher genauso betreten werden kann, wie von der vermeintlichen Bewohnerin des Apartments, bei der es sich um die Luftballonfigur handelt, die im Eingangsbereich auf Einlass wartet. Gleichzeitig suggeriert das System aus Barrieren eine Form von Ereignis oder Spektakel, das hinter der Begrenzung den Besucher überraschen könnte.
Sind die Werke im zentralen Ausstellungsraum zu einem Arrangement verquickt, das genauso verspielt wie grotesk anmutet, weist die Präsentation der Objekte im Untergeschoss eine größere Strenge auf. Diese Arbeiten sind mehrheitlich auf Sand- und Steinsockeln installiert, die den Charakter musealer Präsentationsformen aufgreifen, was dem klassischen Thema von Czudejs Skulpturen zu entsprechen scheint. So spielen die Objekte mit ihren gewundenen Metallarmen formal auf die Skulpturen von Eduardo Chillida an, wobei die Künstlerin die Schwere und Monumentalität der Werke des spanischen Bildhauers durch die Integration von figurativen Details konterkariert. Die Gesichter und Hände, die mit den stabartigen Metallarmen zu interagieren scheinen, verleihen den Werken etwas Comichaftes, was nicht nur der generellen Suche Czudejs nach Narrationen entspricht, sondern ebenfalls die Diskussion um Autorschaft und Geschlechterbilder in den Fokus rückt.
Ergänzt wird die Ausstellung durch einen neuen Film von Czudej, der im Kino des Kölnischen Kunstvereins aufgeführt wird und der eine neue Facette im Schaffen der Künstlerin repräsentiert. Die Arbeit dokumentiert die regelmäßigen Prozesse in jener US-amerikanischen Gießerei, in der die Czudej ihre Skulpturen produzieren lässt, sodass der Film sowohl konzeptuelle Aspekte beinhaltet, als auch auf Gesellschaftsstudien verweist.
Catharine Czudej hatte bereits Einzelausstellungen u. a. bei Office Baroque in Brüssel (2016), Peep-Hole in Mailand (2015) und Ramiken Crucible in New York (2013). Darüber hinaus war sie an zahlreichen internationalen Gruppenausstellungen beteiligt. So zeigte sie Werke u. a. bei Off Vendome in New York (2016), Galerie Eva Presenhuber in Zürich (2016), Eden Eden in Berlin (2015), Zero in Mailand (2014) und François Ghebaly Gallery in Los Angeles (2014).
Anlässlich der Ausstellung erscheint eine Edition.

Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, SHHHHH, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Catharine Czudej, Large Soap Painting 5, 2015, Cortesy Private collection, Belgium 
Catharine Czudej: Untitled, 2016. Foto: Simon Vogel.
-
Einzelausstellung: Andro Wekua – Anruf, 15.4. – 19.6.2016

Andro Wekua, geboren 1977 in Georgien, hat in einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren ein herausragendes Werk geschaffen, das zu den eindrucksvollsten, zugleich aber auch geheimnisvollsten Beiträgen zur jüngeren Gegenwartskunst gezählt werden kann. Ausgehend von seiner eigenen Biografie, die durch die Erfahrung des Bürgerkrieges in seinem Heimatland geprägt wurde, umkreist das Schaffen Wekuas die Frage, wie sich das persönliche bzw. kollektive Gedächtnis konstituiert, was der wahre Gehalt einer individuellen bzw. globalen Erinnerung ist und was in diesem Zusammenhang der Fiktion, der Imagination und Interpretation angehört. Die Bildkreationen, die der heute in Deutschland sowie in der Schweiz lebende Künstler realisiert, weisen dabei zumeist etwas Beängstigendes und Unheimliches auf und verweisen auf Prozesse des Unterbewussten. Unabhängig vom jeweiligen Medium, appellieren die Werke Wekuas unmittelbar an die Gefühlswelt des Betrachters, auch wenn sich diese nicht selten einer eindeutigen Lesbarkeit verweigern, was ihre unbehagliche Wirkung mit beflügelt.
Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein ist nicht nur die erste große Schau des Künstlers im Rheinland, sondern ebenfalls die erste umfassendere Präsentation in Deutschland seit fünf Jahren. Die Werke in der Ausstellung führen die Stringenz innerhalb Wekuas Schaffens in repräsentativer Weise vor Augen. So präsentiert der Künstler in der großen Ausstellungshalle eine komplexe, raumgreifende Installation, die den Betrachter in eine traumartige Welt überführt. Im Zentrum steht dabei eine unbetitelte, lebensgroße Figur (2014), die an exponierter Stelle von der Decke hängt und halb androgyner Mensch, halb Roboter zu sein scheint. Mit dem Kinn balanciert das Wesen auf einer schaukelartigen Vorrichtung und ist damit in einer physisch unmöglichen Haltung wiedergegeben, die die ohnehin schon deutlich ausgeprägte Fremdartigkeit und Entrücktheit der Gestalt noch verstärkt.
Lässt diese skulpturale Arbeit von Andro Wekua Momente des Surrealen und des Fantastischen anklingen, verweist das unbetitelte Seestück (2016), das der Figur in der Ausstellungshalle in merklichem Abstand gegenübergestellt ist, auf eine andere Tradition. So können in dem Gemälde Anspielungen auf die britischen und französischen Landschaftsmalereien des 19. Jahrhunderts, wie auch auf die auf Ausdruck bedachten Pendants des frühen 20. Jahrhunderts nachvollzogen werden, wobei Wekua sein Werk zu einer koloristischen Komposition verdichtet, die die verschiedenen Temperamente des Meeres auf einer psychischen Ebene spürbar macht.
In dem Ausstellungsraum verbinden sich das Bild und die Skulptur zu einer Einheit, für die die eigens entworfene Architektur mit ihren verschiedenen Untergliederungen sowie ihrer intensiven Farbigkeit den Rahmen bildet. Die Wirkung, die sich mit dieser theatralischen Inszenierung verbindet, könnte eindringlicher kaum sein, sodass sie den Rezipienten unmittelbar beeinflusst und sich nachhaltig in dessen Bewusstsein einschreibt.Ergänzt wird dieses installative Konglomerat durch die Präsentation der filmischen Arbeiten von Andro Wekua, die zwischen 2003 und 2012 entstanden und im Kino des Kölnischen Kunstvereins aufgeführt werden. Diese Werke, die teils auf vorgefundenem Material, teils auf eigens produzierten Sequenzen basieren, pendeln zwischen historischem Dokumentar-, Horror- sowie Science-Fiction-Film und zeigen Bilder zwischen Erinnerung, Traum und Vision, die eine nicht minder unter die Haut gehende Atmosphäre vermitteln.
Andro Wekua hatte u. a. Einzelausstellungen in der Kunsthalle Wien (2011), im Fridericianum in Kassel (2011), im Castello di Rivoli in Turin (2011), im Camden Art Center in London (2008), im Boijmans van Beuningen in Rotterdam (2007) sowie im Kunstmuseum Winterthur (2006). 2011 war er zudem für den Preis der Nationalgalerie nominiert.
Die Ausstellung wird gefördert durch:

und mit freundlicher Unterstützung der Julia Stoschek Collection

Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Andro Wekua, Anruf, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Uri Aran – Mice, 13.2. – 27.3.2016

Der Kölnische Kunstverein freut sich, mit Mice die erste umfassende Einzelausstellung von Uri Aran in Deutschland präsentieren zu können. Der 1977 in Jerusalem geborene und mittlerweile in New York lebende Künstler untersucht in seinen Skulpturen, Gemälden, Zeichnungen, Filmen und Fotografien die Grundlagen von Sprache, Kommunikation und Wahrnehmung, die Bedingungen der sozialen Interaktionen sowie die dafür notwendigen gesellschaftlichen Regeln. Als Basis der Arbeiten fungieren zumeist einfache Materialien, Zeichen, Formen, Bilder und Gesten, die Aran derart in Beziehung zueinander setzt, dass sich neue Sinnzusammenhänge ergeben. Dabei erwecken die Konstellationen den Eindruck, Teil einer Narration zu sein, ohne das sich allerdings eine eindeutige Erzählung nachvollziehen ließe.
Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein versammelt sowohl ältere als auch eigens für die Institution produzierte Werke und bietet somit die Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten des Schaffens von Aran. Ein Hauptwerk der Präsentation bildet die in der großen Ausstellungshalle installierte Skulptur Game (2016), die formal auf antike Brettspiele verweist. Die obere Seite des aus Gips gefertigten Werkes ist durch runde, gelegentlich auf Obst und Gemüse verweisende Vertiefungen strukturiert, in denen Metallkugeln, Nüsse und Hundekuchen unterschiedlich arrangiert werden können. Neben der Untersuchung der Frage nach welchen Kriterien die verschiedenen Elemente systematisiert und organisiert werden können, reflektiert die fast schon monumental anmutende Arbeit den Gedanken der Integration des Rezipienten in das Werk, wie auch den Aspekt der Veränderbarkeit einer Skulptur.
Die filmischen Arbeiten Arans, die einerseits Game in der zentralen Ausstellungshalle flankieren und andererseits das Kino des Kölnischen Kunstverein besetzen, lassen demgegenüber die Beschäftigung mit der Gefühlswelt des Rezipienten nachvollziehen. Dabei gilt ein zentrales Interesse der Frage, wie ein auditiver oder visueller Stimulus gebildet und gesendet wird, um eine bestimmte emotionale Reaktion hervorzurufen. Ein Beispiel hierfür ist die Arbeit Black Stallion (2011), bei der es sich um den Abspann des gleichnamigen Filmklassikers des Regisseurs Francis Coppola handelt. Die ergreifende Musik wie auch die Aufnahmen von dem mit einem Pferd spielenden Kind erzeugen bei dem Rezipienten ein Gefühl der Melancholie, dem man sich nur schwerlich entziehen kann.
Eine ähnlich starke Wirkung entfaltet ebenfalls die Arbeit Dog (2006), die den Künstler in Frontalansicht zeigt, wie er weinend einen Hund streichelt, wobei ihm das Tier – gleich der Umarmung zweier Menschen – den Kopf über seine Schulter gelegt hat. Der Film, der formal die Arbeit I’m too sad to tell you des 1975 verschollenen, holländischen Künstlers Bas Jan Ader in Erinnerung ruft, appelliert ohne Umschweife an das Einfühlungsvermögen des Rezipienten. Unweigerlich wird das Gefühl der Betroffenheit und der Trauer erweckt, so dass das manipulative Potential der Bilder sowie des Tons offenbar wird.
Scheinen die genannten filmischen Werke mit einer gewissen, aber keinesfalls überdeutlichen Vehemenz in Erscheinung zu treten, haben die Gemälde und Zeichnungen Uri Arans einen eher unaufdringlichen Charakter. Dabei weisen die Arbeiten, die punktuell in der zentralen Ausstellungshalle sowie im Treppenhaus und umfassender im zweiten Obergeschoss sowie im Rahmen eines druckgrafischen Arbeitsraumes im Keller gezeigt werden, ein relativ weites Spektrum an Ausdrucksformen auf. So pendeln die Gemälde und Zeichnungen zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, wobei sich eindeutig lesbare Portraits oder Szenerien mit gestischen oder farblichen Kompositionen abwechseln. Eingeschriebene Buchstaben und Wörter lassen sich in diesem Zusammenhang in den Arbeiten genauso ausmachen, wie collagierte Fotos oder Alltagsobjekte. Die unterschiedlichen Bestandteile verdichten sich innerhalb der Gemälde und Zeichnungen zu einer Formulierung, der ein unergründliches Geheimnis innewohnt, das ebenfalls als ein wesentliches Merkmal der sonstigen Werke von Uri Aran angesehen werden kann.
In der jüngeren Vergangenheit hatte Uri Aran Einzelausstellungen u. a. bei Peep-Hole in Mailand (2014), in der Kunsthalle Zürich (2013) sowie in der South London Gallery (2013). Darüber hinaus war er an der Whitney Biennial (2014) und der Biennale von Venedig (2013) beteiligt.

Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Mice, Kölnischer Kunstverein, 2016, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Jahresgaben 2015, 2. – 20.12.2015

-
Einzelausstellung: Stephen G. Rhodes – Or the Unpreparedness Prometheus and Pals, 15.11. – 20.12.2015


Stephen G. Rhodes, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung Or the Unpreparedness Prometheus and Pals im Kölnischen Kunstverein 2015 Die Installationen des 1977 in Houston geborenen Künstlers Stephen G. Rhodes sind durch die Nutzung vielfältiger Medien und Materialien gekennzeichnet und weisen zumeist raumgreifenden Charakter auf. Ausgangspunkte der Werke sind in der Regel geschichtliche Ereignisse, gesellschaftliche Phänomene und kunst- oder filmhistorische Positionen, die er einer Untersuchung unterzieht, mit alternativen Wertesystemen konfrontiert und in sein eigenes Sprachsystem überträgt. Für die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein, bei der es sich um die erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland handelt, produziert Rhodes einen neuen Film für das Kino sowie eine komplexe, begehbare Installation für die Ausstellungshalle.
Im Zentrum stehen dabei zwei Orte, deren unterschiedliche Entwicklungen Rhodes im Rahmen seiner Ausstellung miteinander verknüpft und als Basis einer Narration nutzt. Dabei handelt es sich zum einen um das Bayou Corne Sinkhole in einem Sumpfgebiet im Südosten des amerikanischen Bundesstaates Louisiana und zum anderen um das Sweethaven Village auf Malta. Die Erdsenkung entstand 2012, als es in dem Gebiet in Folge des Einsatzes des Fracking-Verfahrens durch ein amerikanisches Industrieunternehmen zu unterirdischen Einstürzen kam und das überirdische Erdreich in die Tiefe gerissen wurde. Hunderte von Anwohnern wurden in der folgenden Zeit aus dem nahegelegenen Ort evakuiert, um sie vor der drohenden Gefahr von weiteren Einstürzen zu schützen.
Das Sweethaven Village auf Malta hat demgegenüber einen weniger belasteten Hintergrund und fungiert in gewisser Weise als Gegenpart zu der amerikanischen Unglücksstätte. Das Dorf entstand 1979/80 als Kulisse für den Popeye-Film des Regisseurs Robert Altman und ist nach dem Abschluss der Dreharbeiten aus Kostengründen nicht zurückgebaut worden, sodass es schliesslich von den Inselbewohnern in einen Vergnügungspark umgewandelt wurde.
Die Welt der Imagination, wie sie sich in dem Sweethaven Village manifestiert, trifft somit auf eine Realität der Industrie, die im Fall des Bayou Corne Sinkholes den Bereich des Unvorstellbaren berührt. Dabei verknüpft Rhodes die Geschichten der beiden Orte sowohl mit dem tagesaktuellen Aspekt der Flucht bzw. des Verlassens, als auch mit der mythologischen Figur Prometheus sowie den Protagonisten des Romans Frankenstein von Mary Shelley.Stephen G. Rhodes lebt und arbeitet in Berlin und New Orleans. Er hatte Einzelausstellung im Migros Museum in Zürich (2013) sowie im Hammer Museum in Los Angeles (2010). Darüber hinaus war an Gruppenausstellungen u.a. in den Kunst-Werken in Berlin (2015), im CCA Wattis Institute for Contemporary Art in San Francisco (2011) sowie im New Museum in New York (2009) beteiligt.

Stephen G. Rhodes, Or the Unpreparedness Prometheus and Pals, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen G. Rhodes, Or the Unpreparedness Prometheus and Pals, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen G. Rhodes, Or the Unpreparedness Prometheus and Pals, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen G. Rhodes, Or the Unpreparedness Prometheus and Pals, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen G. Rhodes, Or the Unpreparedness Prometheus and Pals, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Ketuta Alexi-Meskhishvili – Hollow Body, 15.11. – 20.12.2015


Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel Ketuta Alexi-Meskhishvili, die 1979 in Tiflis geboren wurde und mittlerweile in Berlin lebt, erforscht mit großer Akribie die Möglichkeiten der Fotografie. Ein zentrales Interesse kommt den vielfältigen Methoden der Collage zu, die die Künstlerin mit Virtuosität zum Einsatz bringt. So experimentiert sie mit vorgefundenen und eigenen Bildern oder Materialien und fügt diese in neuen Konstellationen zusammen. Dabei nimmt sie nicht selten Eingriffe an den Vorlagen vor, indem sie diese bewusst zerkratzt, beschneidet oder mit anderen handgemachten Spuren versieht. Die Resultate werden mit analogen oder digitalen Reproduktionsmethoden festgehalten, wobei die entstandenen Bilder meist nur ein Zwischenstadium repräsentieren. Bis zum finalen Abzug werden sie unter dem Einsatz verschiedenster Methoden weiter bearbeitet, sodass das Verfahren eher einem bewussten Komponieren, als dem spontanen Festhalten eines Moments entspricht.
Die Bilder, die die Künstlerin im Rahmen dieses Prozesses entstehen lässt, reichen von Porträts, Stillleben und Architekturaufnahmen bis hin zu Abstraktionen und verweisen auf die jüngere Fotografie- und Kunstgeschichte genauso wie auf die Bildsprache und Ästhetik der Werbung. Unabhängig vom jeweiligen Sujet sind viele der Arbeiten von einer Rätselhaftigkeit geprägt, die nicht unwesentlich zu der Wirkung der Werke beiträgt. Sie wird beflügelt von den Brüchen, die den Fotografien im Zuge des mehrstufigen Produktionsverlaufs innewohnen und die den Rezipienten auf Distanz halten.
Für die Präsentation von Ketuta Alexi-Meskhishvili im Kölnischen Kunstverein, bei der es sich um ihre erste institutionelle Einzelausstellung handelt, wurde eigens eine neue Werkgruppe konzipiert, die sowohl fotografische als auch installative Arbeiten umfasst. Im zweiten Obergeschoss des Hauses wird eine Zusammenstellung von Fotografien präsentiert, der ein transluzenter, mit unterschiedlichen Motiven bedruckter Vorhang im Auge des Treppenhauses gegenübersteht. Zusammengenommen geben die verschiedenen Arbeiten einen umfassenden Eindruck von der Vielschichtigkeit des Schaffens von Ketuta Alexi-Meskhishvili, die in der jüngeren Vergangenheit mit ihren Arbeiten international, wie etwa im New Museum in New York, für Aufsehen sorgte.
Gefördert durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West.

Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ketuta Alexi Meskhishvili, Hollow Body, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: João Maria Gusmão + Pedro Paiva – The Missing Hippopotamus, 29.8. – 25.10.2015


Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel Situationen, in denen das Erklärbare und rational Fassbare auf das Undeutbare trifft, repräsentieren einen der zentralen Interessensbereiche des Künstlerduos João Maria Gusmão (geboren 1979 in Lissabon) + Pedro Paiva (geboren 1977 in Lissabon). Ihren Arbeiten, bei denen es sich um Filme, Fotografien, Camerae Obscurae sowie Skulpturen handelt, zeigen physikalische Experimente, Abläufe der Natur, Episoden des Alltags oder der Geschichte, mit denen sich zumeist geheimnisvolle, nicht selten auch übersinnliche Momente verbinden. Die scheinbar wissenschaftliche, objektive Sicht auf die Dinge, die dabei viele ihrer Arbeiten prägt, überführt das Unerklärliche in die vertraute Realität, löst deren Rätselhaftigkeit allerdings nicht auf.
Die besondere Wirkung der Werke brachte dem Duo schon früh eine größere Aufmerksamkeit ein, so dass die beiden Portugiesen bereits auf eine beachtliche Ausstellungshistorie zurückblicken können. So stellten die Künstler u.a. im CCA Wattis Institute for Contemporary Arts in San Francisco (2008), in der IKON Gallery in Birmingham (2010), im Kunsthaus Glarus in Glarus (2012) oder im Hangar Bicocca in Mailand (2014) aus. 2009 vertraten sie zudem Portugal auf der 53. Biennale von Venedig.
Im Rahmen der Ausstellung im Kölnischen Kunstverein werden erstmals die Skulpturen des Künstlerduos in den Vordergrund gerückt, die im Ausstellungsbetrieb bislang eher selten präsentiert wurden und die in der jüngeren Vergangenheit für die Praxis von Gusmão + Paiva zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Wie in den Filmen und Fotografien, untersuchen die Portugiesen auch mit dieser spezifischen Werkgruppe unser Verhältnis zur Realität und stellen dieses mit viel Feingefühl, Akribie und nicht zuletzt auch mit Humor auf den Kopf. Die in der Regel in Bronze gegossenen Objekte beziehen sich unter anderem auf Alltagsgegenstände, wissenschaftliche Instrumente, Architekturen oder Tiere, die durch ungewöhnliche, bisweilen konträre Konstellationen eine zuweilen surreale Bedeutungsverschiebung erfahren.
Ergänzt werden die, für den Pavillon vorgesehenen skulpturalen Arbeiten durch neue filmische Werke, die eigens für das Kino sowie das Theater des Kölnischen Kunstvereins konzipiert wurden und als ein Paradebeispiel für die Auseinandersetzung der beiden Künstler mit den bewegten Bildern angesehen werden können. Darüber hinaus ist für das ntergeschoss der Institution eine Camera Obscura vorgesehen, so dass durch die Ausstellung nicht nur die Auseinandersetzung mit den Skulpturen von Gusmão + Paiva vertieft werden kann, sondern auch erstmals die Beziehung dieser spezifischen Werkgruppe zu den sonstigen Bereichen ihres künstlerischen Schaffens eindeutig ersichtlich wird.
Die Ausstellung wird durch die Kunststiftung NRW gefördert.

Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Gusmão+Paiva, The Missing Hippopotamus, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Petrit Halilaj – ABETARE, 17.4. – 2.8.2015

Bitte beachten Sie die Unterbrechung in der Ausstellungszeit: 17. April – 7. Juni 2015 / 18. Juni – 2. August 2015
Die Basis der künstlerischen Arbeit von Petrit Halilaj (*1986) bildet dessen noch junger Lebensweg, der maßgeblich von der Geschichte seines Heimatlandes Kosovo bestimmt ist. In Installationen, Zeichnungen, und Filmen setzt er sich mit den Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend auseinander und untersucht mit großem Einfühlungsvermögen Themenkomplexe wie Heimat, Erinnerung und Identität. Dabei verbindet sich mit den Arbeiten des Künstlers, die der Welt eines Geschichtenerzählers entsprungen zu sein scheinen, immer etwas Allgemeingültiges so dass sie den Betrachter unabhängig von dessen Bezug zur jüngeren Geschichte Südosteuropas ansprechen und nachhaltig berühren.
Für die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein entwickelte Halilaj eine umfangreiche Werkgruppe, die sich auf dessen ehemalige Schule in dem kosovarischen Dorf Runik bezieht.
Die Neuproduktion umfasst einen Film, unzählige Skulpturen sowie eine Rauminstallation, die auf das gesamte Gebäude des Kölnischen Kunstvereins verteilt sind, aufeinander verweisen und sich gegenseitig ergänzen. Die früheste Annäherung an den Themenkomplex repräsentiert der im Kino gezeigte Film, dessen Ausgangsmaterial im Jahr 2010 eher zufällig entstand und das Schulgebäude einen Tag vor dessen Abriss zeigt. Halilaj dokumentiert wie junge Schüler von ihren Erinnerungen an die Lehranstalt berichten und dabei die Baustelle erkunden. Passagen lassen zunächst die Neugierde und Freude auf die Veränderungen sowie den kommenden Schulneubau erkennen. Ohne die Präsenz der respekteinflößenden Lehrer wandelt sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen jedoch in eine Form von Aggressivität: Fensterscheiben werden zerschlagen, Bilder von der Wand gerissen oder Farbe an die Wände der Klassenräume gespritzt. Es ist das nicht unvertraute Spiel mit dem Verbotenem, das Momente der Infragestellung und der Auflehnung widerspiegelt.Ganz ähnliche Aspekte klingen in den im Pavillon, Treppenhaus sowie im Atrium des Kölnischen Kunstvereins präsentierten Arbeiten an, die Petrit Halilaj anhand der ehemaligen Bänke und Tische seiner Schule entwickelte. So widmete sich der Künstler den Kritzeleien, Zeichnungen und Schriftzügen, die Schüler einstmals auf dem Inventar der Klassenzimmer hinterließen. Halilaj bildete diese Setzungen stark vergrößert, aus dünnen Stahlstangen nach und transformierte auf diese Weise die sich in den unerlaubten Hinterlassenschaften widerspiegelnde Grenzüberschreitung in etwas Schöpferisches. Dabei bewahren die Objekte trotzt ihrer skulpturalen Form einen eindeutig grafischen Charakter und entfalten in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes die Wirkung von filigranen Zeichnungen im Raum. Die verarbeiteten Motive, u.a. Häuser, Herzen, Vögel, Blumen, Autos, Flugzeuge, Raketen oder Gewehre, zeugen von den Hoffnungen, Sehnsüchten und Träumen genauso wie von den Zweifeln, Ängsten und Sorgen der damaligen Kinder und Heranwachsenden.
Wie vielfältig die Gedankenwelt der Schüler von Runik war, lässt sich im Rahmen einer Betrachtung der ursprünglichen Tische und Bänke nachvollziehen, auf denen sich eine schier unüberschaubare Zahl von Markierungen und Zeichen finden lassen. Petrit Halilaj hat einen Teil des Klasseninventars im Untergeschoss des Kölnischen Kunstvereins zu einer Installation zusammengefasst, wobei er einige der Schulbänke akkurat in Reih und Glied platzierte, während andere zu einem unübersichtlichen Stapel angehäuft wurden. Darüber hinaus hat der Künstler einer kleinen Anzahl von Tischen und Bänken ein besonderes Eigenleben gegeben, das diese von ihrem Dasein als reine Vorbilder befreit: eine Schulbank scheint von skulpturalen Linien gewissermaßen gekapert zu werden, während zwei weitere Repräsentanten des Inventars im Treppenhaus des Gebäudes ins Unerreichbare anwachsen.
Autorität, Normen und Kanons, ihre Akzeptanz wie auch der Widerstand gegen sie, lassen sich als übergeordnete Themen der Ausstellung lesen. Während in dem Film und in den verschiedenen Skulpturen die Wechselwirkung von Annahme und Ablehnung erahnbar wird, rückt die Installation im zweiten Obergeschoss des Kölnischen Kunstvereins ihre Grundlagen in den Vordergrund. Für diese Arbeit hat Petrit Halilaj den gesamt Raum mit einer Tapete ausgestattet, die die erste Fibel des Künstlers, die Titel gebende Publikation ABETARE, zeigt. Seite für Seite des Buches sind an den Wänden erkundbar und rufen den vertrauten Prozess des Lernens vor Augen, wobei neben dem Alphabet ebenfalls die Grundlagen der Gesellschaft vermittelt werden.
Zeitgleich zu der Schau im Kölnischen Kunstverein, richtet die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn ebenfalls eine umfassende Präsentation von Petrit Halilaj aus.
Mit freundlicher Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.


Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Petrit Halilaj, ABETARE, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Ryan McLaughlin – Lacus PM, 6.2. – 22.3.2015

Eröffnung: Do, 5. Februar 2015, 19 Uhr
Mit Lacus PM präsentiert der Kölnische Kunstverein die erste institutionelle Einzelausstellung des US-amerikanischen Malers Ryan McLaughlin. Der 1980 in Worcester, Massachusetts geborene und heute in Sunapee, New Hampshire lebende Künstler hat in den vergangenen Jahren ein herausragendes malerisches Werk erarbeitet, das in Köln anhand von acht Arbeiten aus der Zeit von 2012 bis 2015 vorgestellt wird. Die zumeist mit Ölfarbe auf MDF und Leinwand gefertigten Arbeiten haben etwas Unprätentiöses, was nicht nur auf die Verwendung der reduzierten, unaufdringlichen Farbpalette zurückzuführen ist. Auch die geringe Größe der Arbeiten, die sich zwischen dem Format einer Zigarrenkiste und dem eines Theater- oder Kinoplakates bewegt, trägt zu diesem Eindruck bei. Fanden sich in den Arbeiten von McLaughlin vor wenigen Jahren häufig Stillleben oder Darstellungen von mehr oder minder vertraut erscheinenden Figuren und Alltagsgegenständen in comichafter Manier – wie es zum Beispiel in Chicken Rabbit (2012), dem frühesten Gemälde der Ausstellung nachvollzogen werden kann –, sind die Motive der meisten in Köln versammelten Werke weniger eindeutig kategorisierbar. Vieles ist schemenhaft, wirkt wie angedeutet und lässt sich erst im Zuge einer eingängigen Betrachtung etwas klarer zuordnen. Gelegentlich bieten die deutschsprachigen Titel eine Orientierung, um einen Zugang zu den Gemälden bzw. zu deren Inhalten zu bekommen. Die Bezeichnung Wetter (2014) etwa komplementiert die skizzenhafte Darstellung einer Deutschlandkarte mit entsprechenden Symbolen für Sonne oder Regen wie sie aus Tageszeitungen vertraut ist. Demgegenüber lässt sich das Gemälde Wasserbetriebe (2014) als Verweis auf die Berliner Wasserwerke verstehen, da in der Arbeit ein Teil des offiziellen Schriftzuges des Versorgungsunternehmens adaptiert wird, der unter anderem auf die Darstellung eines tropfenden Wasserhahns sowie eines historischen Dampfschiffes trifft. Die Auseinandersetzung mit Symbolen und Schriftzügen unserer Alltags- und Warenwelt – wie auch die Verwendung des Logos der auf Naturkost spezialisierten Firma Seitenbacher in dem mit Dinkel (2014) betitelten Werk zeigt – scheint einen wesentlichen Ausgangspunkt für die aktuellen Werke des Amerikaners zu bilden, die ihn formal zunächst mit der Tradition der Pop Art verbindet. Doch dort, wo die amerikanische Kunstrichtung allerdings auf die stetige Wiederholung und Reproduktion von zumeist bekannten Zeichensystemen und Ikonen setzte, fokussiert McLaughlin vielmehr periphere Symbole und Schriftzüge, um diese durch ihre schemenhafte Darstellung in den Bereich der Abstraktion zu überführen. Die Beschäftigung mit der abstrakten Malerei repräsentiert insofern einen weiteren wichtigen Aspekt, der die Werke von Ryan McLaughlin prägt. Die Art und Weise, wie der Künstler sich bewusst von klaren Formen entfernt, Flächen ausgestaltet, unterschiedliche Schichten des Farbauftrags und den Duktus des Pinsels ersichtlich werden lässt oder mit unregelmäßigen Strichen und Linien die Grenzen der Gemälde markiert, kann nicht nur als weiterer wichtiger Faktor für die besondere Anmutung der Arbeiten gewertet werden, sondern auch als Anspielung auf die Geschichte sowie die verschiedenen Ausprägungsformen der europäischen wie auch amerikanischen Abstraktion. Darüber hinaus lassen diese spezifischen Merkmale der Arbeiten auch das Interesse an der Fragestellung erkennen, was ein Bild konstituiert und wie sich dieses lesen bzw. dechiffrieren lässt. Diese konzeptuellen Gedankengänge bilden den Hintergrund der in Köln versammelten Werke, vor dem Ryan McLaughlin überzeugende Malereien formuliert, denen eine stille, unaufdringliche Kraft innewohnt.
Öffentliche Führung: 18. Februar 2015, 17 Uhr

Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Ryan McLaughlin, Lacus PM, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Darren Bader – The World as Will and Representation, 6.2. – 22.3.2015


Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel Ausstellung geöffnet ab 5. Februar 2015, 19 Uhr
Ausstellung: 6. Februar – 22. März 2015In der ersten institutionellen Einzelausstellung von Darren Bader in Europa scheint alles anders als erwartet: Nicht nur, dass die Schau im Kölnischen Kunstverein dreierlei Titel trägt, am 6. Februar beginnt, jedoch erst am 27. desselben Monats offiziell eröffnet. Auch die Exponate erwecken den Eindruck, nur schwer greifbar zu sein. So sieht Bader es vor, einige seiner Werke von Woche zu Woche in unterschiedlichen Bereichen innerhalb oder auch außerhalb des Gebäudes zu präsentieren. Andere wiederum werden nur für kurze Zeit Bestandteil der Ausstellung sein.
Doch nicht allein Form und Ablauf der Ausstellung trotzen vermeintlichen Parametern des Ausstellens. Auch die 31 für die Schau vorgesehenen Werke – darunter Klangarbeiten, Filme, Textarbeiten, Objekte und Installationen – versprechen einige Überraschungen. So entsprechen die Arbeiten Baders meist nur in geringem Maße den gängigen Vorstellungen, was ein Kunstwerk sei. Dies ist nur am Rande darauf zurückzuführen, dass Bader in vielen seiner Werke auf die mittlerweile über ein Jahrhundert alte Tradition des von Marcel Duchamp begründeten Readymade-Prinzips rekurriert und alltägliche Objekte zu Kunst erklärt. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eher der Gesichtspunkt, wie Darren Bader den besagten Gedanken einsetzt und welche Implikationen sich mit den Arbeiten verbinden. Mit vielen Arbeiten verbinden sich nämlich bestimmte Bedingungen, Aufgaben und Herausforderungen, die definieren, wie mit dem jeweiligen Objekt umzugehen ist. Im Unterschied zu seinem französischen Kollegen integriert Bader insofern viel stärker den Rezipienten in seine Arbeiten. Bei der verlockend klingenden Arbeit Pretty Face, die wie alle Werke des Künstlers undatiert ist, bestimmt jeder Besucher individuell, was ein „schönes Gesicht“ ausmacht. Der künstlerische Beitrag liegt somit allein in der Definition des Rahmens, während dem Rezipienten die Aufgabe zukommt, eine Wahl zu treffen. Je nach Besucher kann die Kür somit unterschiedlich oder sogar gar nicht erfolgen.
Fragen nach der Autorschaft, wie sie bei Pretty Face evoziert werden, kennzeichnen auch Arbeiten wie To Have and to Hold – object J1, bei der die – zumeist optionalen – Aufgaben und Möglichkeiten des Besitzers noch deutlicher zum Tragen kommen: Das Werk basiert auf der Idee, dass der Eigentümer der Arbeit ein Buch über Candida Höfers Fotografien von On Kawaras Datumsbildern erwirbt, es ein Jahr lang studiert, beliebig lang weitere Exemplare der Publikation ansammelt und diese schließlich in den Alltag anderer Personen einführt. Die Erscheinungsform der Arbeit ist somit keinesfalls statisch, sondern – in Abhängigkeit vom Sammler – in einem steten Prozess.
Eine andere Form der Beschäftigung mit Fragen nach der Autorschaft zeigt sich zudem in der Arbeit 110 x 5 x 166.5 cm, bei der es sich um die Fotografie von einem Jungen in den angegebenen Maßen handelt. Für die Umsetzung dieser Arbeit betätigte sich Bader nicht etwa als Fotograf, sondern kaufte das Werk eines Kollegen, das er im Folgenden als seine eigene Kreation ausgab und die fotografische Arbeit dabei zu einer Skulptur umdeklarierte. Unweigerlich lässt sich in diesem Akt nicht nur die kritische Auseinandersetzung mit den Mechanismen des Kunstmarktes nachvollziehen, sondern auch die scharfsinnige Untersuchung, wann und wie etwas zu einem Werk wird.
Über die klassische Konzeptkunst, mit der das Schaffen von Darren Bader immer wieder in Beziehung gesetzt wird, gehen die sich in den erwähnten Arbeiten widerspiegelnden Gedanken weit hinaus. Insbesondere die Momente des Absurden, die in vielen Stücken nachvollziehbar sind, repräsentieren ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zu der in den 1960er Jahren begründeten Kunstrichtung. Das Abwegige und Aberwitzige mancher Werke weist vielmehr in Richtung Surrealismus, der im Zuge einer intensiveren Auseinandersetzung mit Baders Praxis als wichtiger Einfluss erkennbar wird. Dieser Umstand tritt besonders deutlich in einer Werkgruppe hervor, für die Bader gegensätzliche Objekte, Begriffe und Gedanken zu Paaren zusammenfasst und damit auf eine Strategie rekurriert, die von der französischen Avantgardebewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert wurde. Im Rahmen der Ausstellung zählen zu dieser Gruppe perfume with/and trapezoid, pair of jeans and/with $228, patella with/and theater tickets, sugar and/with axe sowie glasses with/and glasses, für die potentiell jeweils x-beliebige Repräsentanten der verschiedenen Objekte genutzt werden können. Dabei lässt sich insbesondere aufgrund der Alltäglichkeit der verwendeten Gegenstände ein starker Unterschied zu den Werken des Surrealismus ausmachen, da diese zumeist eindeutiger als Kunstwerke konzipiert waren.
Die Tatsache, dass Bader für die Mehrheit seiner Arbeiten auf vorgefundene Gegenstände zurückgreift, erschwert in vielen Fällen die Möglichkeit, Objekte mit Bestimmtheit als Exponat zu erfassen. Dieser Faktor lässt daher auch das Bestreben erahnen, die Grenzen zwischen Kunst und Nicht-Kunst auszuloten und diese ggfs. gänzlich aufzulösen. Im Kölnischen Kunstverein treibt der Amerikaner die besagten Ambitionen insbesondere mit Werken wie person sitting in passenger seat of car auf die Spitze, für das vor dem Ausstellungshaus zu bestimmten Zeiten – wie der englischen Bezeichnung gemäß – irgendeine Person auf dem Beifahrersitz irgendeines Autos sitzt. Ohne das Wissen über die Arbeit würde man das Kunstwerk somit unausweichlich übersehen und die Szenerie – wenn überhaupt – als eine Alltagssituation empfinden.
Gelingt mit person sitting in passenger seat of car eine Gradwanderung zwischen der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit eines Werkes, verfolgt Bader mit dem Film OSS, der eigens für den Kölnischen Kunstverein produziert wurde, gänzlich andere Ziele. Für den animierten Science-Fiction-Film schrieb Darren Bader das Drehbuch, das von einem wunderlich-komischen Wettbewerb bei den Vereinten Nationen handelt, in dessen Rahmen der Vorschlag ausgelost wird, Skulpturen für den Weltraum zu bauen. Den skurrilen Wesenszügen seiner sonstigen Arbeiten entsprechend sind auch die kosmischen Werke in gewisser Weise sonderbar, umfassen diese doch u.a. ein Fußballstadium, tausende Kuben gefrorener Kuhmilch oder etwa eine gigantische menschliche Hand, die in ferner Zukunft ins All gesandt werden. Darren Bader bietet mit OSS somit ein absurdes Theater, das irgendwo zwischen fantastischer Zukunftsvision, dem Glauben an die uneingeschränkten Möglichkeiten der Kunst sowie überambitioniertem Kunstfilm anzusiedeln ist. Zugleich erweitert er mit OSS das Spektrum seiner künstlerischen Praxis, deren Komplexität man bislang ohnehin schon kaum Herr werden konnte.
Neben OSS eröffnet auch die ebenfalls speziell für den Kölnischen Kunstverein produzierte Klangarbeit audio files neue Kategorien innerhalb des Werkes von Darren Bader: Auf 32 Lautsprechern präsentiert Bader nahezu zeitgleich hunderte von Musikstücken, die sich u.a. auf das Alte Testament, seine Kreditkartennummer, Hegels Dialektik, Edelgase oder die Bestandteile einer Linzer Torte beziehen. Das Resultat dieses ungewöhnlichen Zusammenspiels ist ein ohrenbetäubendes Getöse, das mit immenser Wucht den Kopf des Rezipienten verdreht und vielleicht jenes Geräusch erahnen lässt, das entsteht, wenn Darren Bader mit viel Humor die begrenzenden Mauern zwischen Konzeptkunst, Surrealismus und anderen Kunstformen zum Einstürzen bringt.

Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, The World as Will and Representation, Kölnischer Kunstverein, 2015, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Darren Bader, white towel, 2015. Foto: Simon Vogel.
-
Einzelausstellung: Annette Kelm – Staub, 7.11. – 21.12.2014

Eröffnung: Donnerstag, 6. November 2014, 19 Uhr
Ausstellung: 7. November – 21. Dezember 2014Annette Kelm, 1975 in Stuttgart geboren, zählt zu den herausragenden Vertreterinnen einer jüngeren Garde von Fotografen, die international mit einem neuen Blick auf die Welt für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Mit ihren Einzelaufnahmen und Bildserien, die unter anderem Arrangements von Objekten des Alltags, Portraits, Architekturen und Landschaften oder ungewöhnlich anmutende Narrationen wiedergeben, schafft Kelm Bilder, mit denen sie nicht nur die Funktionsweise unserer Wahrnehmung und unseres Sehens offenlegt, sondern ebenfalls kultur- und gesellschaftspolitische Themen reflektiert.
Trotz der konzeptuellen Komponenten, die das Werk der Künstlerin kennzeichnen, sind die Bilder von einer subtilen, aber zugleich berührenden Emotionalität und Stimmung geprägt, welche die Arbeiten zu faszinierenden und lange nachhallenden Gebilden macht.
Im Kölnischen Kunstverein wird insbesondere das Schaffen der Künstlerin der letzten fünf Jahre in den Fokus gerückt und anhand einer Auswahl von repräsentativen, zum Teil erstmals öffentlich gezeigten Arbeiten vorgestellt.
Öffentliche Führungen zur Ausstellung:
19. November, 17 Uhr mit Moritz Wesseler
17. Dezember, 17 Uhr mit Carla DonauerMit freundlicher Unterstützung der:


Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Annette Kelm, Staub, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Andra Ursuta – Scytheseeing, 28.6. – 30.9.2014

Ein scheinbar mumifizierter Frauenkörper, bedrohliche Sensen, Modelle des Elternhauses der Künstlerin, deformierte Betonbunker, aufblasbare Textilfäuste oder anthropomorphe Obelisken – das Werk der 1979 im rumänischen Salonta geborenen und in New York lebenden Künstlerin Andra Ursuta, das insbesondere Skulpturen und Installationen umfasst, entfaltet durch seine düstere, bisweilen morbide oder martialische Symbolik sowie Anspielungen auf vergangene oder gegenwärtige Systeme der Macht und Gewalt eine irritierende und eindringliche Wirkung.
Ausgangspunkt der Werke Ursuta`s sind zumeist persönliche Erfahrungen und Erinnerungen, die mit ihren osteuropäischen Wurzeln, den kulturellen Codes Rumäniens und ihrer Familiengeschichte verbunden sind. Diese werden von der Künstlerin mit Eindrücken der Gegenwart sowie mit aktuellen Themen verknüpft. Bilder und Vorstellungen, die sich im kollektiven oder in ihrem individuellen Bewusstsein eingeschrieben haben, finden in den Arbeiten eine neue, für den Betrachter befremdliche und zum Teil verstörende Existenz. Dabei sind ihre Werke keinesfalls als Provokation angelegt; vielmehr sind sie gespickt mit kunst- und kulturhistorischen Referenzen. Eine scheinbar entwurzelte, durch rautenartige Elemente strukturierte und mit einer stachelähnlichen, tödlichen Spitze versehene Holzsäule weckt nicht nur Erinnerungen an Constantin Brâncușis La colonne sans fin (Unendliche Säule), 1918-1938, sondern ebenso an die Gräueltaten des brutalen rumänischen Herrschers Vlad III. Drăculea, der Mitte des 15. Jahrhunderts im Widerstandskampf gegen das Osmanische Reich seine Vorliebe für die Hinrichtung durch Pfählung auslebte. Durch die Ummantelung des Ass to Mouth betitelten Objektes mit schwarzem Gummi erhält die Arbeit zudem sexuelle Konnotationen, so dass sie zwischen sehr unterschiedlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten oszilliert.
Die Auseinandersetzung mit der Psychologie des Menschen, mit dessen Emotionen, Sehnsüchten und Obsessionen wie auch Ängsten und Albträumen findet in den Arbeiten von Ursuta ebenso unmittelbaren Widerhall wie ihre eigene Biografie, soziale Rollenmodelle und kulturelle Konventionen.
Mit Scytheseeing präsentiert der Kölnische Kunstverein nicht nur die erste institutionelle Einzelausstellung von Andra Ursuta in Deutschland, sondern zugleich auch die bis dato umfassendste Werkschau der Künstlerin in Europa. Denn zusätzlich zu einer Gruppe eigens für die Ausstellung produzierter Arbeiten zeigt Ursuta eine Auswahl an Werken, anhand derer sich die Entwicklungen ihres künstlerischen Schaffens der letzten Jahre nachvollziehen lässt.
In der jüngeren Vergangenheit machte Ursuta bereits durch ihre Teilnahme an der 55. Biennale von Venedig (2013) sowie an Gruppenausstellungen im MoMA PS1 (2013) und im New Museum (2011) in New York sowie durch Einzelausstellungen bei Peep-Hole in Mailand (2014) und im Hammer Museum in Los Angeles (2014) international auf sich aufmerksam.
Führungen durch die Ausstellung: 2. Juli, 17 Uhr mit Moritz Wesseler und 6. August, 17 Uhr mit Carla Donauer

Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz 
Andra Ursuta, Scythseeing, Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Uli Holz
-
Einzelausstellung: Uri Aran – Sensitivo, 28.6. – 30.9.2014

Die Erforschung von Sprache und Kommunikation sowie die Untersuchung der zwischenmenschlichen Beziehungen bilden einen wesentlichen Ausgangspunkt für die Arbeit des 1977 in Jerusalem geborenen und mittlerweile in New York lebenden Künstlers Uri Aran.
Die Werke des Israelis sind allerdings keinesfalls mit wissenschaftlichen Studien zu verwechseln. Sie lassen sich vielmehr mit poetischen oder philosophischen Gedankenspielen in Verbindung bringen, die in Form von Installationen, Skulpturen, Zeichnungen oder Filmen einen Ausdruck finden. Im Rahmen der Präsentation im Kölnischen Kunstverein wird das Schaffen Arans anhand von ausgewählten Filmen erstmals in Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.Filme:
Unitled, 2006, 03:24 Min.
Mud, 2010, 07:40 Min.
Uncle in Jail, 2012, 21:03 Min.

Uri Aran, Sensitivo, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Sensitivo, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Sensitivo, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Sensitivo, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Uri Aran, Sensitivo, Kölnischer Kunstverein, 2014,
-
Einzelausstellung: Claus Richter – Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, 28.6. – 30.9.2014


Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Kölnischer Kunstverein, 2014, Foto: Simon Vogel Wie rochen die Mitglieder des Kölnischen Kunstvereins im 19. Jahrhundert? Spielte ein Vorstandsvorsitzender des Hauses in einem Puppentheater mit? Was hatte es mit der Flagge des Kunstvereins auf sich?
Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Kölnischen Kunstvereins hat der in der Domstadt lebende Künstler Claus Richter (geboren 1971 in Lippstadt) ein einmaliges Projekt konzipiert, das – basierend auf ausgeklügelten Räuberpistolen – eine humorvolle und überraschende Hommage sowohl an die Institution als auch an die rheinländischen Gefilde und Bräuche darstellt. Das Projekt versammelt unter dem Titel Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914 insgesamt zehn eigens für den Anlass entworfene Objekte, die von einem Kunstvereins-Flakon des berühmten Eau de Cologne, über eine den Vorstandsvorsitzenden karikierende Puppendarstellung um die Jahrhundertwende bis hin zu der, über Jahrzehnte in der Kirche St. Aposteln verwahrten, Vereinsflagge reichen. Entsprechend der Vielschichtigkeit der berührten Themen können die von Claus Richter entworfenen Stücke an verschiedenen öffentlichen Orten der Stadt besichtigt werden, sodass die Ausstellung einem Spaziergang durch Köln und dessen Geschichte gleicht.
Im Rahmen der Ausstellung dienen ein speziell zum Projekt erscheindendes Künstlerbuch (Claus Richter: Verse und Bilder, 2014) sowie regelmäßige Führungen zur Vermittlung des Projekts, das zweifelsohne einen der schönsten Höhepunkte des 175-jährigen Jubiläums des Kölnischen Kunstvereins darstellt.
Führungen:
Samstag, 30. August 2014, 12.30 – 14.00 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr
Sonntag, 14. September 2014, 15 – 16.30 Uhr
Sonntag, 28. September 2014, 15 – 16.30 UhrDer Vortrag von Claus Richter zur Eröffnung am 29. August 2014 ist HIER zu sehen.
Mit Dank an:
Museum Ludwig Köln
Kölnisches Stadtmuseum
MAKK
Duftmuseum des Farina Hauses
St. Aposteln
Karnevalsmuseum KölnMit freundlicher Förderung von:



verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Apostelnkirche Köln, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Apostelnkirche Köln, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Farina Duftmuseum Köln, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Kölnischer Kunstverein, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Kölnischer Kunstverein, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Kölnischer Kunstverein, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation MAKK Köln, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Museum Ludwig Köln, 2014, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Höchst seltsame Chronologie verschiedenster Ereignisse des Kölnischen Kunstvereins der Jahre 1839 bis 1914, Installation Museum Ludwig Köln, 2014, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Nathalie Djurberg & Hans Berg – Maybe This Is A Dream, 9.4. – 1.6.2014

Das Künstlerduo Nathalie Djurberg & Hans Berg (*1978, Schweden), das durch eindringliche Trickfilme international große Bekanntheit erlangte und 2009 mit einem Löwen der Biennale Venedig ausgezeichnet wurde, zeigt im Rahmen seiner Ausstellung im Kölnischen Kunstverein eine Auswahl an Filmarbeiten sowie großformatigen Skulpturen.
In den in Stop-Motion gefertigten Filmen, die bislang den größten Teil der Produktion der beiden Künstler ausmachten, treten zumeist Figuren aus Knetmasse in Erscheinung, die formal die Welt von Kinderfilmen nachklingen lassen. Durch ihre Inhalte und Handlungsstränge verweisen sie allerdings auf zum Teil skurrile Traum- und Albtraumwelten. Die Themen dieser filmischen Arbeiten sind die elementaren Fragestellungen des menschlichen Daseins, die um Liebe, Macht und Gewalt kreisen.
Die jüngste Arbeit The Black Pot, die im Zentrum der Kölner Ausstellung steht, kommt hingegen ohne Figurenarsenal aus und weist quasi abstrakte Züge auf. Der auf Zeichnungen basierende Animationsfilm zeigt den sich stetig wiederholenden Prozess der Entstehung, Veränderung und Auflösung von Formen und spielt damit auf die vielfältigen Kreisläufe der Natur und des Universums an.
Begleitet werden die bewegten Bilder, wie die bisherigen Animationsfilme des Duos, von elektronischer Musik, die Hans Berg eigens für die Arbeiten komponiert. Im Kölnischen Kunstverein werden die filmischen Arbeiten durch riesige Donut- und Eiskulpturen ergänzt, die den großen Saal einnehmen und verwandeln werden.
Die Ausstellung wird von der Düsseldorfer Sammlerin Julia Stoschek großzügig unterstützt, die die beiden Künstler bereits seit einigen Jahren begleitet.

Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nathalie Djurberg und Hans Berg, Maybe this is a dream, Kölnischer Kunstverein, 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Pietro Roccasalva – F.E.S.T.A., 8.2. – 23.3.2014

Eröffnung der Ausstellung: 7. Februar 2014, 19 Uhr
Ausstellung: 8. Februar bis 23. März 2014
Der Kölnische Kunstverein freut sich mit F.E.S.T.A. die erste institutionelle Einzelausstellung des italienischen Künstlers Pietro Roccasalva in Deutschland zu präsentieren. Die Schau umfasst sowohl ältere als auch neuere Arbeiten Roccasalvas und gibt einen Querschnitt durch die unterschiedlichen Werkbereiche des Künstlers.
Seit mehr als zehn Jahren entwickelt der italienische Künstler Pietro Roccasalva ein Werk, das sich nur schwer bestimmen lässt und als einer der eigensinnigsten Beiträge zur Gegenwartskunst angesehen werden kann. Das Schaffen des 1970 geborenen Künstlers ist von einer medialen Vielfalt geprägt und umfasst einerseits Gemälde sowie Zeichnungen, die von bemerkenswerten handwerklichen Fähigkeiten zeugen und teils große Ähnlichkeiten zu altmeisterlichen Ikonen aufweisen. Andererseits schafft er auch Skulpturen, Installationen, Fotografien, Filme sowie Performances, die in dem gegenwärtigen Kunstdiskurs viel eher auszumachen wären. Der Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Werkbereichen bildet sich über Inhalte und Narrative die den Arbeiten zugrunde liegen und ihren Ursprung im Gedankenkosmos des Künstlers haben. Roccasalva verwebt persönliche Erfahrungen mit Referenzen an die Kunstgeschichte, die Literatur, die Musik sowie an das Kino, so dass sich die Werke nicht selten zwischen unterschiedlichen Realitäts- und Fiktionsebenen bewegen.
Dabei sind die Werke des Künstlers in einer besonderen Weise miteinander verknüpft: Jede Arbeit, die Roccasalva produziert, verweist auf ihren unmittelbaren Vorgänger wie auch auf ihren Nachfolger. Das bisherige Oeuvre Roccasalvas verhält sich in gewisser Weise wie ein immenses Spiegelkabinett, wobei das Labyrinth nicht selten auch mit Hohl- und Zerrspiegeln ausgestattet zu sein scheint. Mit dem Schaffen Roccasalvas verbindet sich ein Geheimnis, das sich nicht auflösen lässt und sich deshalb lange ins Gedächtnis einschreibt.
Roccasalva erlangte durch seine Teilnahme an der 53. Biennale von Venedig und seinen Beitrag zur Manifesta 7 internationale Aufmerksamkeit, zuletzt wurde der Künstler in einer umfassenden Einzelausstellung im Le MAGASIN, Grenoble gezeigt.
Sonntags 17 Uhr Filmvorführung des 35 mm Films Truka (D’après Andreij Rublëv by A. Tarkovsky)
Führungen durch die Ausstellung: 19. Februar (Carla Donauer) und 19. März (Moritz Wesseler) um 17 Uhr

Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Pietro Roccasalva, F.E.S.T.A., Kölnischer Kunstverein 2014, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Sean Snyder – No Apocalypse, Not Now, 9.11. – 22.12.2013

Sean Snyder wurde 1972 in Virginia Beach in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren und studierte an der Rhode Island School of Design in Providence, an der Boston University in Boston sowie an der Städelschule in Frankfurt. Seit Mitte der 1990er Jahre hat Snyder ein Werk entwickelt, das um die Entstehung, Bedeutung und Wahrnehmung von Informationen, Bildern und Codes kreist und in Form von Filmen, Texten und Installationen in Erscheinung tritt.
Im Kölnischen Kunstverein wird das Schaffen Snyders nun erstmals in Deutschland in umfassender Weise vorgestellt. In der Ausstellung No Apocalypse, Not Now, deren Titel sich unmittelbar auf Jacques Derridas gleichnamige Schrift über atomare Endzeitvisionen sowie die Politik der Abschreckung bezieht, wird anhand von dreizehn aufeinander abgestimmten Arbeiten ein tieferer Einblick in die Praxis des Künstlers ermöglicht.Die Ausstellung erstreckt sich dabei nicht nur auf den zentralen Pavillon des Gebäudes, dessen Fenster eigens für das Projekt mit Wänden ausgestattet wurden, sondern auch auf das Untergeschoss sowie den Kinosaal. Im großen Ausstellungspavillon des Kunstvereins wird der Besucher mit insgesamt zehn filmischen Arbeiten konfrontiert. Diese Werke umfassen nicht nur einen substantiellen Zeitraum von zehn Jahren, sie repräsentieren ebenfalls einen zentralen Teil des künstlerischen Schaffens von Snyder und vermitteln ein grundlegendes Verständnis für dessen Praxis und Herangehensweise.
Snyder nutzt als Basis seiner Arbeit unterschiedlichste Formen von Quellenmaterial, das von Nachrichten- Werbe-, Unterhaltungs- oder Amateurclips über Informationen aus öffentlichen bzw. staatlichen Datenbanken bis hin zu Sequenzen aus privaten Blogs und auch selbst produzierten Bildern reicht. Dieses Material extrahiert und sichtet Snyder, unterzieht es systematischen Untersuchungen und klopft es auf dessen Bedeutung und deren Zustandekommen ab. Auf diese Weise legt der Künstler die Mechanismen der Informations- und Bildproduktion in der heutigen, globalen Medienwelt offen und hinterfragt diese, ohne allerdings eine Wertung vorzunehmen. Die Themenfelder, die er im Zuge seines Schaffens berührt, umfassen zentrale Fragestellungen und Ereignisse der jüngeren Vergangenheit sowie der Gegenwart. Die Beziehung zwischen Bildern und Ideologien sowie gesellschaftliche und politische Systeme bilden das übergeordnete Interessensund Forschungsfeld des Künstlers.Die filmischen Arbeiten im Ausstellungspavillon werden auf sogenannten Hantarex-Monitoren gezeigt, die entsprechend der künstlerischen Konzeption von Snyder auf Sockeln im Raum platziert und damit in gewisser Weise zu einem installativen Arrangement zusammengeschlossen sind. Die Aufstellung der Monitore ist hierbei nicht hierarchisch und folgt der Chronologie der Werke, wobei die Ältesten am Anfang und die Jüngsten am Ende der Halle aufgestellt sind. Die Tonspuren, welche die filmischen Sequenzen einiger Arbeiten begleiten, sind dabei nicht aufeinander abgestimmt, so dass sie sich teilweise überlappen.
Die Filme des Künstlers werden von Fotos und Drucken ergänzt, die an jeweils an den Stirnwänden der Halle installiert sind. Diese Arbeiten gehören zu Snyders Index, bei dem es sich um ein 2008 begonnenes Projekt handelt, das die systematische Erfassung seines, über die Jahre für die Produktion der Filme angesammelten Bild- und Datenarchivs umfasst. Ziel dieses Unterfangens ist es, sämtliche seiner Materialien im Internet öffentlich nutzbar zu machen, während die physischen Quellen in Folge der Transformationsprozesse zerstört werden. Im Kontext der andauernden Beschäftigung von Sean Snyder mit der Entstehung und dem Transfer von Informationen und Bildern, kann der mit der Erstellung von Index verbundene Prozess gewissermaßen als logische Konsequenz seiner Arbeit angesehen werden. Die in der Ausstellung präsentierten Filme verhalten sich zu dem in Index inkorporierten Archiv von Bildern und Informationen wie Essenzen, die nicht unbedingt einen höheren Wert, sondern eher eine andere Erscheinungsform markieren.
Demgegenüber stellen die gezeigten Fotos und Drucke physische Produkte der Beschäftigung Snyders mit dem Index dar, der in diesem Zusammenhang zum Ausgangspunkt gänzlich neuer Werke wurde. Diese zeigen beispielsweise Speichermedien, die der Künstler für das Archiv nutzte und die in der Manier sachlicher Dokumentationsfotos festgehalten sind. Andere Resultate des Index zeigen wiederum Nahaufnahmen und Details von Gegenständen aus dem Archiv, die nicht mehr dechiffrierbar sind und daher recht abstrakt anmuten.Während die im Ausstellungspavillon präsentierten Werke in direkter oder indirekter Beziehung zu Index stehen, sind die Arbeiten im Untergeschoss und Kino unabhängig von diesem Projekt zu betrachten. Diese Filme, bei denen es sich um Exhibition (2008) und Afghanistan, circa 1985 (2008 – 09) handelt, entstanden als Snyder bereits mit den Arbeiten an Index begonnen hatte und wurden aus diesem Grund von den Werken im Pavillon separiert. Der im Untergeschoss ausgestellte Film Exhibition basiert auf einer sowjetischen Dokumentation aus den 1960er Jahren und zeigt eine Ausstellung von Reproduktionen unterschiedlicher Kunstwerke in einem ukrainischen Dorf. Die Arbeit thematisiert einerseits den ideologischen Gehalt des für den Film genutzten Quellenmaterials und liefert andererseits eine Reflexion über den institutionellen Charakter von Museen. Im Gegensatz dazu führt Afghanistan, circa 1985 dem Betrachter eine Begegnung zwischen einheimischen Afghanen und sowjetischen Truppen vor Augen. Die Grundlage des Werks bildet dabei Filmmaterial, das in den 1970er und 1980er Jahren während der sowjetischen Besetzung des Landes entstand. Zunächst wird eine Sequenz ohne Unterbrechung und Veränderung wiedergegeben, um dann erneut in verlangsamter Form, gewissermaßen Bild für Bild, rekapituliert zu werden. Auf diese Weise gelingt es Sean Snyder nicht nur die Formeln und Konventionen der Machtrepräsentation beider Kulturkreise nachvollziehbar zu machen, sondern zudem noch einmal die Funktion und Wirkung von Bildern im Medienzeitalter darzustellen. Die thematische Relevanz wie auch die Akribie und Präzision, die sich mit Afghanistan, circa 1985 – und ebenso mit den sonstigen Arbeiten – verbinden, können dabei wohl als eines der wesentlichen Charakteristika der künstlerischen Praxis von Sean Snyder angesehen werden und tragen maßgeblich dazu bei, dass dessen Werke einen lang anhaltenden Nachklang aufweisen.
Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
Ausstellungs-Öffnungszeiten:
Dienstag – Sonntag 11 – 18 Uhr, an Feiertagen geschlossenMit freundlicher Unterstützung von:
Stiftung Kunst und Soziales der Sparda-Bank West (Jahrespartner 2013)
Kunststiftung NRW
RheinEnergieStiftung Kultur
Stadt Köln
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Sean Snyder, No Apocalypse, Not now, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht
-
Einzelausstellung: Ceal Floyer, 6.9. – 20.10.2013

Die in Berlin lebende Künstlerin Ceal Floyer, die mit ihrer scharfsinnigen und zumeist poetischen Konzeptkunst in den vergangenen Jahren international große Beachtung erfuhr, präsentiert im Kölnischen Kunstverein eine ortsspezifische Ausstellung, die nicht nur die besonderen architektonischen Bedingungen des Gebäudes reflektiert, sondern auch einen Einblick in ihre künstlerische Praxis ermöglicht.
Der Eingriff, den Ceal Floyer in der großen Ausstellungshalle des Kölnischen Kunstvereins vorgenommen hat, wirkt recht umfassend, auch wenn die Mittel hierfür eigentlich eher minimal erscheinen. An den großen Fenstern des Pavillons sind unzählige Aufkleber schwarzer Vogelsilhouetten installiert, wie man sie von den verglasten Fassaden öffentlicher Gebäude kennt. Es sind die schattenartigen Umrisse von Bussarden, die echte Vögel durch ihre abschreckende Wirkung davor schützen sollen, gegen die durchsichtigen Scheiben zu fliegen. Entgegen der üblichen Installationsweise, die eine sporadische Platzierung der Aufkleber vorsieht, sind die Bussarde im Rahmen von Ceal Floyers 2002 entstandener Arbeit Warning Birds – die das zentrale Werk der Ausstellung darstellt – dicht an dicht gesetzt. Der Blick durch die Glasscheiben wird insofern eingeschränkt, so dass die Fenster ihre eigentliche Funktion kaum noch erfüllen können. Durch ihre spezifische Setzung weisen die Vögel fast einen ornamentalen Charakter auf, der gelegentlich davon ablenkt, dass die Arbeit auf eindringliche Weise auch Erinnerungen an die bekannten Angriffsszenen aus Alfred Hitchcocks Klassiker Die Vögel wachruft. Durch die Veränderung gewohnter Parameter gelingt Floyer insofern eine grundlegende Bedeutungsverschiebung, die ein weites Feld von Assoziationen zulässt, auch wenn die Arbeit, wie es deren Titel vermittelt, nichts anderes als Warning Birds zeigt
Der unterschwellige Humor, der sich in der Arbeit durch die scheinbar absurde Steigerung des Auftrags der Warning Birds nachvollziehen lässt, verbindet sich mit einer Vielzahl der Werke von Floyer, so dass dieser fast schon als ein Kennzeichen ihrer Praxis angesehen werden kann. Diese besondere Form des Witzes prägt ebenfalls die 1999 entstandene Arbeit Bucket, die von Floyer ganz bewusst in den Kontext der raumgreifenden Installation der Warning Birds integriert wurde. Die Arbeit besteht aus einem gewöhnlichen, schwarzen Eimer, der innerhalb der Ausstellung recht überraschend und vielleicht sogar etwas deplaziert wirkt, so dass sich Unsicherheit einschleicht, ob das Behältnis nicht etwa versehentlich zurückgelassen wurde. In regelmäßigen Abständen wird ein Geräusch wahrnehmbar, das an das stete Tropfen eines Wasserlecks erinnert. Unweigerlich richtet sich der Blick des Betrachters in Richtung der Hallendecke, wo das Leck vermutet werden könnte. Doch Anhaltspunkte für einen Wasserschaden lassen sich in diesem Bereich nicht ausmachen. Die Erklärung für das ungewöhnliche Geräusch findet sich letztendlich im Inneren des Eimers. In diesem sind ein portabler CD-Spieler sowie eine Box arrangiert, die den irritierenden Klang erzeugen. Keines der Geräte ist verborgen und die Voraussetzungen für die Illusion sind somit unmittelbar ersichtlich.
Auch wenn Floyers Arbeit auf die, seit langer Zeit in der Kunstgeschichte verankerte Tradition der Täuschung Bezug nimmt, scheint sie dieser in gewisser Weise zu widersprechen. Ihre Arbeit schafft eine Illusion, um im nächsten Moment deren Grundlagen offen zu legen und diese wieder aufzulösen.
Die Arbeit Rock Paper Scissors, die 2013 entstand und die Bucket innerhalb der, gewissermaßen als Rahmenwerk fungierenden Installation Warning Birds ergänzt, kommt demgegenüber ohne Täuschungstricks aus. Das Werk besteht aus drei quadratischen Bildtafeln, die jeweils einen Stein, ein Papier sowie eine Schere zeigen und damit auf das weit verbreitete und gleichnamige Spiel verweisen, bei dem mit den Händen die verschiedenen Zeichen nachgebildet werden. Als Grundlage der Arbeit fungierten Bilder, die Floyer nicht selber produzierte, sondern als ‘Found footage’, als gefundenes Material einfach übernahm. Die drei Motive, aus denen sich das Werk zusammensetzt, illustrieren einerseits den Titel der Arbeit und verweisen andererseits auf das, mit den realen Gegenständen verknüpfte Zeichen- und Bedeutungssystem, mit dem sich in der Welt des Spiels Regeln und Handlungen verbinden. Die gleichzeitige Sichtbarkeit aller drei Objekte widerspricht dabei den Bedingungen des Spiels und stellt dadurch die Verbindung zwischen realem Gegenstand und dem dahinter liegenden Zeichensystem in Frage, so dass die Arbeit auch als Stillleben lesbar wird. Floyers Rock Paper Scissors umkreist insofern das Verhältnis von Sprache, Zeichen und Bildern.Die Ausstellung von Ceal Floyer im Kölnischen Kunstverein beginnt aber nicht erst im Pavillon des Riphahn-Baus. Schon nach dem Betreten der großen und lichten Eingangstüren des Gebäudes, wird der Besucher von einer leisen, aber durchaus stimmungsvollen Musik begrüßt, die ihn zu der Flügeltür des Kinos lockt. In dem abgedunkelten Saal wird er dann mit Floyers 2013 entstandenen Filmarbeit Untitled Credit Roll konfrontiert, die beim Besucher in gewisser Weise den Eindruck erweckt, zu spät zu einer Filmvorführung gekommen zu sein. Weiße, abstrakte und zum Teil wolkenartige Gebilde und Formationen laufen langsam vom unteren zum oberen Rand der Leinwand und verweisen im Zusammenspiel mit der Musik auf den klassischen Abspann eines Filmes. Die Schriftzüge, Namen und Funktionsbezeichnungen werden unscharf wiedergegeben und lassen sich nicht mehr lesen, so dass man vermuten könnte, dass die Linse des Filmprojektors verstellt wurde. Der oftmals übersehene Schluss einer Filmvorführung, bei dem viele Zuschauer schon den Saal des Kinos verlassen, wird von der Künstlerin im Rahmen der Arbeit in den Vordergrund gerückt und zur eigentlichen Attraktion erhoben.
Floyer kehrt die Bedeutung der Dinge um und lenkt die Aufmerksamkeit von einer Haupt- auf eine Nebensächlichkeit. Die Raffinesse und der Scharfsinn, den sie dabei an den Tag legt, erweist die Künstlerin als eine Meisterin ihres Metiers und begründet die besondere Qualität ihrer vielfältigen Praxis.
Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
Ausstellungs-Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr, Montags und an Feiertagen geschlossenMit freundlicher Unterstützung von:
Stiftung Kunst und Soziales der Sparda-Bank West (Jahrespartner 2013)
RheinEnergieStiftung Kultur
Stadt Köln
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht 
Ceal Floyer, Kölnischer Kunstverein 2013, Installationsansicht
-
Einzelausstellung: Stefan Müller – Allerliebste Tante Polly, 18.4. – 2.6.2013


Stefan Müller, Penny Lane, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. Die Ausstellung zeigt Arbeiten des in Köln lebenden Künstlers Stefan Müller (*1971 in Frankfurt am Main). Seine Malereien werden in einer Installation präsentiert, die ihre Inspiration aus der Lektüre von Mark Twains Roman “Die Abenteuer des Tom Sawyer” (1876) bezieht.
Auf den ersten Blick erscheinen die Arbeiten Stefan Müllers abstrakt. Grob definierte Rechtecke, oft leger ausgemalt, schwanken in instabilen Beziehungen durch einen malerischen Raum aus Bleiche, Spritzern und Farbverläufen. In anderen Bildern brechen zahllose, im Batikverfahren entstandene Falten die farbgetränkte Leinwand in ein Spektrum aderförmiger Linien auf. Der Bildgrund erinnert an die nebelhaften Abbildungen milchstraßendurchzogener Galaxien oder entfernter Gebirge auf ausgeblichenen Atlasseiten. Vor diesem Hintergrund tanzen nicht selten Spuren und Aussparungen, die von Klebestreifen, Schmutz, Krümeln oder Ascheresten herrühren — bewusst in den Grundierungsprozess mit aufgenommene Unwägbarkeiten. Der Künstler folgt diesen Zufällen, lässt sich bei der Setzung neuer Farbtöne und Formen von ihnen leiten oder abschrecken, korrigiert oder betont sie noch. Dann finden sich wieder Stellen, an denen ölige Binnenflächen —vom Nesselstoff aufgesaugt— als Entourage pastos leuchtender Farbaufträge verlaufen. Kringel überlagern und durchschneiden sich gegenseitig bis ihre Acryl- und Bleicheschlieren unsauber ineinander verlaufende Sogwirkungen entfalten. Manche dieser Formen können als Referenzen an andere malerische Diskurse gelesen werden. So erinnern die beschriebenen Kringel teilweise an die Zielscheibenmotive Kenneth Nolands oder an Poul Gernes, aber so, als wären diese stark verwaschen und verrutscht. Jedoch ist das Erkennen von Bezügen und Zitaten nicht ausschlaggebend, um Stefan Müllers Malerei zu lesen. Diese Malerei ist kein Referat über Malerei. Interessanter ist es, Stefan Müllers Umgang mit Leinwand, Farbe, Material und Technik weniger abstrakt sondern vielmehr als konkrete Auseinandersetzung mit Sehnsüchten, Beziehungen, dem eigenen Erleben und der alltäglichen Suche nach Transzendenz zu betrachten. Linien und Figuren zum Beispiel, deren Farben sich während ihres vagen Verlaufs flackernd verändern, assoziieren Gemütszustände. Oder es gibt farbige Streifen, aus denen sich Drippings lösen, die wiederum andere, darunter liegende farbige Streifen durchkreuzen, umfärben und sich dabei selbst verändern; wie Menschen, die anderen Menschen begegnen. Anderswo verdichten sich Buntstiftlinien zu Spiralen, die um sich selbst kreisen wie Gedanken, die zu keinem Schluss führen. Immer wieder greift der Künstler auf Formen des Erlebens zurück, die man sich in der Kindheit als selbstverständlich herausnahm, deren Gebrauch dann aber irgendwann auf dem langen Weg des Erwachsen-Werdens verloren ging; Verfahren, die außerhalb der Logik des Zu-Etwas-Zu-Gebrauchen-Seins existieren. So gibt es den schönen Titel eines älteren Bildes von 2002, der dies einfach erläutert: “Zu lange in die Sonne geschaut”. Die abstrakt gemalten Kreise im Bild werden durch den Titel als etwas absolut konkretes und einfaches erkennbar, als Reflexionen auf der Netzhaut; eine sowohl persönliche aber zugleich auch mit anderen teilbare Erfahrung. Durch sein nahezu romantisches Insistieren auf dem einfachen und doch fragilen Zusammenhang zwischen persönlicher und ästhetischer Erfahrung, zwischen Erleben und Mitteilen, ist es Müller gelungen, seine Arbeit aus den für die Nullerjahre symptomatischen Kniffen und Finten postkonzeptueller Malereibehauptungen heraus zu halten ohne solipsistisch zu werden.
Søren Grammel
(Kurator der Ausstellung)Die Ausstellung wird gefördert durch:
Land NRW – Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
Stadt Köln
Stiftung Kunst und Soziales der Sparda-Bank West (Jahrespartner 2013)
Rhein Energie Stiftung Kultur
Stefan Müller, Alllerliebste Tante Polly, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Foto: Albrecht Fuchs 
Stefan Müller, Alllerliebste Tante Polly, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Foto: Albrecht Fuchs 
Stefan Müller, Autoluminescent, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Die Elster kam jeden sie mochte Bob Dylan, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Gegen den Blitz mit Spiegel, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Gehen wohin der Wind sich lehnt, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Ich bin Du, jetzt lass mich rein, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Iris-Blende Jacksons Island, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Oh Happy Day (One Hit Wonder), 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Penny Lane, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Tante Pollys Garten, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Traurige Enden, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Troubled Kids Airlines, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller, Warmer Bass, 2013. Foto: Albrecht Fuchs Courtesy Galerie Nagel Draxler, BerlinKöln & Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt a.M. 
Stefan Müller: King Georg Lampenfieber, 2012.
-
Einzelausstellung: Thea Djordjadze – november, 16.2. – 31.3.2013


Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs Thea Djordjadze wurde 1971 in Tiflis, Georgien, geboren. Sie studierte Bildhauerei in der Klasse von Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf. Von 2004 bis 2007 war sie Atelierstipendiatin des Kœlnischen Kunstvereins. Nun präsentiert der Kunstverein ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland seit 5 Jahren. Wie häufig im Kunstverein handelt es sich um eine spezifische Neuproduktion, die unverwechselbar ist und in direkter Auseinandersetzung mit dem Ort entsteht.
Ein wiederkehrendes Element vieler Arbeiten Thea Djordjadzes sind schlanke Holz- oder Stahlprofilkonstruktionen. Die mehrfach Richtung und Länge wechselnden Verstrebungen erinnern an axonometrische Zeichnungen. Es sind geometrische Figuren, deren Geraden und Winkel aufgebrochen und verdreht wurden. Ihre Umrisse deuten nicht zu Ende gedachte Flächen und Volumen an. Teilweise machen sie den Eindruck seltsam gefalteter Umrisse von diversen Einrichtungsgegenständen. Die Strukturen funktionieren in Kombination mit Objekten, die aus Holz, Ton, Papiermaché und anderen Materialien hergestellt wurden. Hinzu kommen Teppiche oder Teppichbodenstücke, Glasscheiben oder zugeschnittene Platten. Die Fragmente sind durch lose Verfahren wie Stellen, Legen und Lehnen miteinander verbunden. Sie sind spekulativ, temporäre Anordnungen. Ihre Bemalung scheint provisorisch ausgeführt. Zum Beispiel, wenn dünn angerührter Gips oder unverdünnte Wandfarbe auf weiches Material wie Schaumstoff oder Teppichboden aufgetragen sind.
Djordjadzes Skulpturen erinnern teilweise an die Raumfaltungen der russischen Futuristen oder der De Stijl Gruppe, unterscheiden sich jedoch wieder deutlich von diesen durch biomorphe, manchmal surreal, manchmal folkloristisch wirkende Gestaltungselemente. Hinzu kommt ein fast erzählerischer Umgang mit dem Interieur als Motiv: Stuhl, Tisch, Bett, Paravent. Das visuelle Ausgangsmaterial für ihre Ensembles nimmt die Künstlerin im Design und der Architektur der von ihr durchreisten oder benutzten Umgebungen wahr. Dabei liefern vor allem der familiäre Zusammenhang in Georgien und die Reisetätigkeit als international ausgestellte, in Berlin lebende Künstlerin die topografischen Koordinaten dieser Rezeption. Es sind heterogene Raumkonzepte, deren Erfahrung die Künstlerin interessiert. Situationen, in denen Gebrauch, Improvisation und das Aufeinandertreffen diverser, oft gegensätzlicher kultureller Praktiken eine Rolle spielen. Djordjadze transplantiert Bilder und Gegenstände aus dem Zusammenhang ihrer ursprünglichen Funktions- und Erscheinungsweise heraus und überträgt sie in die spekulative Umgebung ihrer eigenen künstlerischen Arbeit. Kulturelle Realität und Widersprüche —die sich im Ausgangsmaterial als Normalität repräsentiert finden— werden in diesem Prozess wieder aufgelöst und neu verhandelt.Die Moderne erscheint in Thea Djordjadzes Werk als Konstruktion, deren universalistischer Anspruch schon immer durch die Pluralität kultureller und geografischer Austauschverhältnisse relativiert ist. In einem Kino zeigte die Künstlerin anlässlich ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Basel (2009) den Film “Das Salz Swanetiens” von Michail Kalatosow. Der Film dokumentiert den Zusammenprall von Modernisierung und Archaik in der postrevolutionären Sowjetrepublik Georgien. Sowjetische Filmemacher wollten die sozialistische Perspektive —auch bildsprachlich— in die durch patriarchale Traditionen geprägten Südränder der jungen Räterepublik tragen. Umgekehrt wurde aber die Filmsprache der jungen Revolutionäre durch die vorgefundenen sozialen und geografischen Strukturen ebenfalls verändert. Ein ähnliches Verhältnis wird in Djordjadzes Arbeit reflektiert, wenn sie einen folkloristischen Fransenteppich über eine axonometrische Holzkonstruktion legt. Auch das Ornament des Teppichs wird relativiert. Dessen Schmuckseite ist nach innen gefaltet; die ungewollt modern wirkende —weil herstellungsbedingt mechanistische— Rückseite bleibt dagegen sichtbar.
Søren Grammel, Kurator der Ausstellung
Freitag 15. Februar 2013
ab 19 Uhr Eröffnung der Ausstellung
außerdem
ab 20 Uhr Konzert
Alfons Knogl mit Daniel Ansorge & Holger Otten
The World In Pieces
danach Party mit DJ Korkut ElbayDie Ausstellung wird gefördert durch
Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, Jahrespartner 2013
und
Kunststiftung NRW
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs 
Thea Djordjadze, november, Kölnischer Kunstverein, 2013, Installationsansicht, Courtesy Galerie Sprüth Magers, Foto: Albrecht Fuchs
-
Ausstellung: Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, 3.11.2012 – 6.1.2013

Janice Kerbel, Hilary Lloyd und Silke Otto-Knapp sind drei Künstlerinnen, deren jeweiliges Werk in den letzten Jahren erheblich an internationaler Beachtung gewonnen hat. Die britische Künstlerin Hilary Lloyd (*1964) wurde für den Turner Prize 2011 nominiert und zeigte dieses Jahr eine Einzelausstellung im Museum für Gegenwartskunst Basel. Die Kanadierin Janice Kerbel (*1969) präsentierte ihre Werke zuletzt mit Einzelausstellungen u.a. in der Chisenhale Gallery (London) und im Art Now-Programm der Tate Britain. Die in Niedersachsen geborene Künstlerin Silke Otto-Knapp (*1970) stellte in den letzten Jahren u.a. im Berkeley Art Museum (Kalifornien) oder bei greengrassi (London) aus.
Die drei Künstlerinnen werden ihre unterschiedlichen Arbeiten in einer gemeinsam gestalteten Installation miteinander in Bezug setzen und dabei malerische, filmische und konzeptuelle Verfahren zusammenführen. Ein wiederkehrendes Motiv der Ausstellung wird dabei die Auseinandersetzung mit der Beziehung sein, die zwischen den inhaltlichen Referenzen künstlerischer Produktion und den dramaturgischen sowie stilistischen Mitteln ihrer Inszenierung besteht. Es ist charakteristisch für Janice Kerbel, Hilary Lloyd und
Silke Otto-Knapp, dass ihre Werke einen forschenden, erprobenden Zugang gegenüber dem eigenen bildnerischen Material und dessen Dispositionen einnehmen, und diesen zugleich mit einer besonders starken Behauptung und Hinterfragung des Visuellen koppeln. Visualität erscheint in den drei Praktiken als ein assoziatives und emotionales Instrumentarium, das — vielleicht aufgrund seiner besonderen Ambivalenzen und Interpretationsspielräume — zum Umgang mit verschiedenen kulturellen Lebens- und Wissensbereichen besonders geeignet ist.Ausstellungsbooklet Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, 2012
Das Projekt wird großzügig durch die Kunststiftung NRW gefördert.
Our special thanks goes to Sadie Coles HQ London. Without
her support the realisation of Hilary Lloyd’s works would not have been
possible.Also many thanks to Scott Cameron Weaver, Museum für Gegenwartskunst Basel,
greengrassi London, Overduin & Kite Los Angeles, Galerie Buchholz Köln,
Galerie Karin Guenther Hamburg.Eröffnung
Freitag, 2. November, 19 UhrBegrüßung
Dr. Wolfgang Strobel
Vorstandsvorsitzender Kœlnischer Kunstverein
und
Søren Grammel
Direktor Kœlnischer KunstvereinParty
DJ Hans Nieswandt
Freitag, 2. November, 22 Uhr
Ein Fest für und mit allen Cologne ContemporariesBegleitprogramm:
Direktorenführung
Samstag, 3. November, 19 Uhr
Zur Langen Nacht der Kölner MuseenKuratorengespräch
Dienstag, 6. November, 18 Uhr
Søren GrammelFührung
Donnerstag, 15. November, 18 Uhr
Marion RückerFührung
Mittwoch, 19. Dezember, 18 Uhr
Sofie Mathoi
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht 
Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, Kölnischer Kunstverein, 2012, Installationsansicht
-
Ausstellung: Große Jahresgabenausstellung, 29.9. – 10.10.2012

205 Werke von 111 Künstlerinnen und Künstlern zum Erwerb
Editionen & UnikateErstmals wird die Ausstellungshalle des Kœlnischen Kunstvereins zum Schau- und Umschlagplatz einer großen Jahresgabenausstellung. Wir haben unser Sortiment dieses Jahr durch einen besonders hohen Anteil an Einzelstücken erweitert.
Mit Paweł Althamer, Norbert Arns, Atelier & Steven Purvis, Alice Aycock, Mark Bain, Rosa Barba, Merlin Bauer, Maggie Bauer & Michel Sauer, Bernd & Hilla Becher, Boris Becker, Johannes Bendzulla, Joseph Beuys, Heike Beyer, Andri Bischoff, Bernhard Johannes Blume, Thomas Böing, Cosima von Bonin, Manfred Boecker & Wolfgang Niedecken, Wolfgang Breuer, Ruth Buchanan, Liudvikas Buklys, Michael Buthe, Marianna Christofides, Eli Cortiñas, Josef Dabernig, Walter Dahn, Sara Deraedt, Christina Doll, Angus Fairhurst, Ian Hamilton Finlay, Kerstin Fischer, Oskar Fischinger, Olivier Foulon & Willem Oorebeek, Albrecht Fuchs & Das Institut, Douglas Gordon, Thomas Grünfeld, Owen Gump, Thea Gvetadze, Adam Harrison, Lone Haugaard Madsen, Simon Hemmer, Julia Horstmann, Katharina Jahnke, Cameron Jamie, Pernille Kapper Williams, Janice Kerbel, Michael Kerkmann, Viola Klein, Alfons Knogl, Peter Kogler, Běla Kolářová, Bernd Krauß, Adolf Krischanitz, Marie Lund, Ann Mandelbaum, Nick Mauss, Pauline M’barek, Bärbel Messmann, Michaela Meise, Almut Middel, Jugoslav Mitevski, Bernadette Mittrup, Johanna von Monkiewitsch, Alex Morrison, Stefan Müller, Christa Näher, David Ostrowski, Silke Otto-Knapp, Stephen Prina, Florian Pumhösl, Claus Richter, Ulla Rossek, Maruša Sagadin, Gerda Scheepers, Lasse Schmidt Hansen, Frances Scholz, Nora Schultz, Sery C., Sean Snyder, Stephanie Stein, Monika Stricker, Sarah Szczesny, Sofie Thorsen, Rosemarie Trockel, Franz Erhard Walther, Lawrence Weiner, Nicole Wermers, Christoph Westermeyer, Johannes Wohnseifer, Heimo Zobernig.
Support: Salon Verlag (Ed. Gerhard Theewen) featuring Edition Ex Libris mit Thomas Demand, Marcel Dzama, Marcel van Eeden, Candida Höfer, Thomas Huber, Jack Pierson, Peter Piller, Gregor Schneider, Norbert Schwontkowski, Thomas Struth, Wolfgang Tillmans, Gert & Uwe Tobias, Rosemarie Trockel, Rachel Whiteread.Alle gezeigten Kunstwerke können während der Ausstellung von Mitgliedern des Kœlnischen Kunstvereins sowie von Nicht-Mitgliedern (zahlen einen kleinen Aufschlag) erworben werden.
Käufer können auch im Onlineshop per Formular bestellen:
Hierzu das Menü JAHRESGABE öffnen.Wir bedanken uns respektvoll bei den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sämtliche Gewinne geteilt werden. Alle Einnahmen, die der Kœlnische Kunstverein durch die Jahresgabenausstellung erzielt, fließen in die Produktion kommender Ausstellungen. Erwerben Sie Kunst zu Vorzugspreisen und fördern Sie damit zugleich den relevantesten Verein Kölns für die Produktion und Ausstellung zeitgenössischer Kunst.
Neue Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr
Samstag & Sonntag, 11 bis 18 UhrDie Ausstellung ist am 3. Oktober von 11-18 Uhr geöffnet.
-
Einzelausstellung: Bernd Krauß – Das ist heute möglich, 30.6. – 9.9.2012


Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Magiccan 2003 Eröffnung Freitag 29. Juni 2012, 19 Uhr
In seinen Arbeiten verwendet Bernd Krauß (*1969) Verfahren aus Malerei, Zeichnung, Skulptur, Video, Fotografie, Druckgrafik, Performance und Theater. Hinzu kommen diverse Langzeitprojekte wie beispielsweise die Produktion einer mittels Kopierladen und Internet vervielfältigten Wurfsendung mit dem boulevardhaften Titel Der Riecher.
In seinen Objekten, Aktionen, Bildern und einem improvisierten Fernsehsender (Sender Mittelfranken) saugt Krauß den Alltag um sich herum kontinuierlich auf, um ihn zum Material seiner Kunst zu machen. Der Gebrauch von nicht-künstlerischen Formaten und alltäglichen Handlungsformen prägt seine Arbeitsweise ebenso wie die offensichtlich bewusste Distanzierung zum routinierten Künstlertypus, der durch Wiederholung seine bestimmten Methoden verfeinert und dann im Kunstsystem verbreitet. Dagegen nimmt Krauß eher die Haltung des Hobbyist-As-Professional ein – zum Beispiel als freiwilliger Mitarbeiter in einem Zoo oder bei der Vertiefung in das Wettgeschäft mit Trabrennpferden -, um sich von sonst üblichen Betriebsabläufen nicht einschränken lassen zu müssen.
In seinen vielsprachigen Installationen verdichten sich scheinbar locker gesetzte Gesten und ein eigenwilliger Formalismus zu unberechenbaren Projektionsflächen.Bernd Krauß lebt in Stockholm.
Ausstellungsbooklet Bernd Krauß 2012

Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Huibuh 2004/2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: ABC 2003 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Konkret vs. Abstakt 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Große An- und Ausziehuhr 2003 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Kapuzenpullover 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Garderobe seit 1992 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Avocado 2005 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Obsession 1996 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Gestern 2011 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Chanel 2007 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: mammutbaumhecke 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: mammutbaumhecke 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: mammutbaumhecke 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Unit 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Magiccan 2003 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Magiccan 2003 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Diplom 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Diplom 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Diplom 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Diplom 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Diplom 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Diplom 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Schlesien ist unser 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: More than two balls 1995 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Herr Mueller 1998 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Doppelkomfort 2004 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Tor Tür 2004/2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Teddy mit Lachs 2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Hannah Arendtenteisen 2008 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Verkehrskontrolle 2004/2012 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Pressrelease 1997 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Der Riecher seit 1998 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht 
Bernd Krauß, Das ist heute möglich, Kölnischer Kunstverein 2012, Installationsansicht, Detail: Der Riecher seit 1998
-
Ausstellung: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, 19.4. – 10.6.2012


Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Sara Deraedt. Chantal Akerman, Ruth Buchanan, Liudvikas Buklys, Saim Demircan, Sara Deraedt, _fabrics interseason (Wally Salner, Johannes Schweiger), Lasse Schmidt Hansen, Benjamin Hirte, Marie Lund, David Maljkovic, Michaela Meise, Nicole Wermers, Heimo Zobernig.
Die Arbeiten in der Ausstellung sind vorrangig aus einfachen Materialien und Baustoffen geformt. Sie reflektieren alltäglichen Gebrauch. Ihr Blick auf die Welt ist ein transzendenzloser. Der Sublimität des Minimalismus stellen sie ihre pure Physikalität gegenüber. Ihre Quelle ist der Baukasten, aus dem Normalität konstruiert ist.
Auf der Referenzebene verweisen manche der Arbeiten auf halböffentliche oder private Räume, wie sie der Identitätskonstruktion sinngerichtete Kontexte bieten. Die Verschiebungen, welche die Arbeiten gegenüber ihren funktionalen Vorbildern markieren, können minimal sein und doch Skepsis vermitteln. Wenn der Polizist sagt: “Halt, bleiben Sie stehen!”, so fragt sich die Ausstellung, was der in einem Gebäude verlegte Teppichboden zu sagen hat? Was hat der Architekt geplant? Wie wurde das Leben der Verbraucher/-innen imaginiert?
Die Ausstellung fragt nach dem Verhältnis gebauter Umgebungen zu den durch sie formulierten Ideen und Programmen. Jedem Produkt formaler Gestaltung ist die Utopie eines Raums angeschlossen, in dem es idealerweise erscheinen könnte. Dieser abstrakt entworfene Raum ist zugleich immer ein politischer Raum, der bestimmte Ordnungen und Identitäten definiert. Diese Perspektive lenkt den Blick auch auf den Aspekt der Autorität von Gestaltung, der im 20. Jahrhundert als moderne Ambivalenz zwischen Emanzipation und Kontrolle, zwischen Ermächtigung und Rationalisierung sichtbar wurde. Wie korrespondieren die gebauten Oberflächen und ihre Zwischenräume mit dem Leben, das darin stattfindet?
Søren Grammel, Kurator der Ausstellung
(Der Titel der Ausstellung ist dem Text Open Display For Particular Viewership von Ruth Buchanan entliehen.)
Das Projekt wurde teilgefördert durch ‘Kunsten en Erfgoed’.
Ausstellungsbooklet: A wavy line is drawn across the middle of the original plans

Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: _fabrics interseason. 
Installationsansicht A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail Benjamin Hirte, Chantal Akerman. 
Installationsansicht A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail Benjamin Hirte, Liudvikas Buklys. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Benjamin Hirte, Saim Demircan, Liudvikas Buklys. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Benjamin Hirte, Saim Demircan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Benjamin Hirte. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Chantal Akerman, Heimo Zobernig, Benjamin Hirte, Saim Demircan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Chantal Akerman. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Chantal Akerman. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Heimo Zobernig, _fabrics interseason, Ruth Buchanan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Heimo Zobernig, Benjamin Hirte, Saim Demircan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Heimo Zobernig, Benjamin Hirte. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, _fabrics interseason, Teppich nach Klee, David Maljkovic. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, _fabrics interseason, Teppich nach Klee, David Maljkovic. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, Nicole Wermers, Teppich nach Klee, David Maljkovic. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, Nicole Wermers, Teppich nach Klee, David Maljkovic. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, Ruth Buchanan, _fabrics interseason, Teppich nach Klee. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Lasse Schmidt Hansen, Ruth Buchanan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Marie Lund, Heimo Zobernig, Nicole Wermers, Lasse Schmidt Hansen, Michaela Meise. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Marie Lund. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Michaela Meise. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Nicole Wermers, David Maljkovic. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Nicole Wermers, Heimo Zobernig, Marie Lund. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Nicole Wermers, Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Nicole Wermers. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Ruth Buchanan, Benjamin Hirte. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Ruth Buchanan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Ruth Buchanan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Ruth Buchanan. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Sara Deraedt. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Sara Deraedt. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Sara Deraedt. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Teppich nach Klee, David Maljkovic, Marie Lund, Heimo Zobernig. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Teppich nach Klee, David Maljkovic. 
Installationsansicht: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, Detail: Teppich nach Klee, David Maljkovic, Marie Lund, Heimo Zobernig.
-
Einzelausstellung: Omer Fast, 22.10. – 20.12.2011


Omer Fast, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung des Künstlers im Kölnischen Kunstverein 2011, Design: Manuel Raeder Omer Fasts Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein, in der er seine neue Arbeit 5000 Feet is the Best (2011) und die dreiteilige Videoarbeit Nostalgia (2009) präsentiert, ist die abschließende Ausstellung im Programm der Kunstvereinsdirektorinnen Kathrin Jentjens und Anja Nathan-Dorn. Omer Fast (geb. 1972) ist für Filme und Videoarbeiten bekannt, welche die spezifischen formalen Möglichkeiten von Film und Fernsehen nutzen, wie beispielsweise das Durchmischen von Dokumentarischem und Fiktion, das Spiel mit Ton, Bildebene und Schnitt. Die pluralen Sichtweisen und Stimmen, die er so in seine Geschichten integrieren kann, negieren das Authentische. Es sind Arbeiten über die Möglichkeiten des Erzählens.
5000 Feet is the Best handelt von Piloten unbemannter, amerikanischer Drohnen, die von multiplen Monitoren umgeben in Containern arbeiten. Die Computertechnologie ermöglicht es ihnen beispielsweise, zu beobachten, wie ein Mann am anderen Ende der Welt eine Zigarette raucht oder welche Schuhe er trägt – eine quasi intime visuelle Wahrnehmung, die der Pilot in gleicher Weise hat, wenn er Bomben von einer Drohne zu ihrem Ziel steuert. Der digitale Film, der auf einem Gespräch des Künstlers mit einem ehemaligen Piloten basiert, mischt das dokumentarische Material mit fiktiven Elementen. Der Pilot weicht den Fragen des Interviewers immer wieder aus, indem er scheinbar belanglose Anekdoten erzählt. Diese Geschichten mischen sich in den Bildern des Films mit unseren eigenen Vorstellungen vom Krieg im vorderen Orient und von Las Vegas. Mehr und mehr nimmt der Film allerdings die Leerstelle in den Fokus, die zwischen unserer medial geprägten Wahrnehmung dieses Themas und den traumatisierenden Erlebnissen des Piloten besteht.
Im Untergeschoss des Kunstvereins begegnet der Besucher einer neuen, zweiteiligen Dia- und Videoarbeit von Omer Fast: Her face was covered (2011). Sie funktioniert wie ein Nachbild zu 5000 Feet is the Best. Das Video zeigt die Vorbereitungen für den Dreh einer Filmszene nach der Explosion einer Bombe. Die Bilder sind von einem Kran aus aufgenommen, so dass die Perspektive der Aufnahme der Art der Beobachtungen einer Drohne ähnelt. Im Voice Over erzählt ein Drohnenpilot, wie und warum er Befehl erhält, eine Frau zu eliminieren. In der Diaprojektion hat Omer Fast die Sätze der Erzählung in die Bildersuchmaschine von Google eingegeben. Einige der Bilder, die er so im Internet gefunden hat, scheinen völlig absurd und beliebig, andere treffen die Situation genau. Sie wirken wie ein Schatten der Erzählung, die sich aus einem alltäglichen Bilderreservoir zusammensetzt.
Nostalgia ist eine dreiteilige Videoinstallation. Ausgehend von der Tonaufnahme eines Gesprächs mit einem Flüchtling aus Nigeria verwickelt Omer Fast den Betrachter in eine Geschichte über illegale Einwanderer und die scharf kontrollierte Grenze zwischen Afrika und Europa. Nostalgia besteht aus einem kurzen dokumentarischen Video, einer Installation mit zwei Monitoren, die eine inszenierte Interviewszene zwischen einem Afrikaner und einem Regisseur zeigt, und einer in der Vergangenheit angesiedelten Science-Fiction, in der Europäer durch Tunnelsysteme aus einem zerstörten und unsicheren Europa in ein sicheres Afrika flüchten. Joseph Conrads Novelle Herz der Finsternis ähnlich, ist die narrative Struktur von Nostalgia wie eine russische Matrjoschka-Puppe strukturiert, in der eine Narrationsebene die nächste öffnet. So erzählt der von Omer Fast befragte Afrikaner im ersten Teil von Nostalgia, wie ein älterer Soldat ihm, als er Kindersoldat war, beibrachte, Rebhuhnfallen zu bauen. Auch in den folgenden Videos der Arbeit beschreiben Schauspieler unterschiedlicher Figuren eben diese Schlingfalle. Je tiefer der Betrachter in das Dickicht aus unterschiedlichen Perspektiven, Zeit- und Realitätsebenen eindringt, desto mehr scheint sich die Schlinge um ihn zuzuziehen.
Für die Unterstützung der Ausstellung von Omer Fast möchten wir uns herzlich bei Dr. Arend und Dr. Brigitte Oetker, Julia Stoschek, Sabine DuMont Schütte, der Botschaft des Staates Israel und Köllefolien bedanken.
-
Ausstellung: CHTO DELAT – Perestroika. Twenty Years After: 2011-1991, 26.8. – 18.9.2011


Chto Delat? Perestroika. Twenty Years After 2011 - 1991, Ankündigung zur Ausstellung im Kölnischen Kunstverein 2011 Das russische Künstlerkollektiv Chto Delat? wurde 2003 von Künstlern, Kunstkritikern, Philosophen und Autoren aus Sankt Petersburg und Moskau gegründet. In ihren vielfältigen Aktivitäten verbinden sie politische Theorie, Kunst und Aktivismus. Das emanzipatorische Potential des Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes sowie die Rolle der Kultur in diesen Prozessen sind Themen, mit denen sich die Mitglieder der Gruppe sowohl gedanklich als auch in ihren Aktionen auseinandersetzen. Der Name Chto Delat? bedeutet übersetzt ‚Was ist zu tun?’ und ist dem Titel eines Romans von Nikolay Chernyshevsky aus den 1860er Jahren entliehen, in dem der Autor einen minutiösen Plan für den Aufbau einer sozialistischen Arbeiterorganisation entwirft. Vladimir Lenin übernahm den Namen später für sein politisches Konzept. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Gruppe ist die Reflexion über die Form des Künstlerkollektivs und dessen Bedeutung in der Vergangenheit und der Gegenwart und über den Einfluss, den Kollektivität auf die Produktion und Rezeption von Kunst hat.
Die Ausstellung Perestroika. Twenty years after: 2011-1991 ist die erste Einzelausstellung des international renommierten Künstlerkollektivs in Deutschland. Chto Delat?’s künstlerische Arbeit ist zutiefst politisch in ihrer Aufarbeitung von russischer Geschichte und zeitgenössischen Ereignissen. Die Ausstellung reflektiert die Entwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft in Russland nach der Perestroika 1991, als die Soviet Union aufgelöst und die Russische Föderation gegründet wurde. Die Ausstellung ist wie ein umgekehrter historischer Countdown strukturiert und beginnt im Kino der Brücke mit dem Film Tower: A Songspiel (2010). Der Film gibt einen Einblick in die jüngste, öffentliche Diskussion um die Pläne des staatlich kontrollierten Energiekonzerns Gazprom für den Bau des Okhta Centers in der Altstadt von Sankt Petersburg. Der Bau des Hochhauses hätte die berühmte Stadtsilhouette der historischen Altstadt, die auch UNESCO Kulturerbe ist, zerstört.
Betritt der Besucher den Ausstellungsraum, wird er zunächst von einer Installation aus Texttafeln und Plakatwänden, Videoarbeiten verschiedener Schaffensperioden des Kollektivs und von aus Holztafeln geschnittenen Skulpturen umgeben. Die hölzernen Silhouetten stellen auf den ersten Blick Figuren aus russischen Märchen und historische nationale Symbolcharaktere dar. In ihre jeweiligen grotesken Gegenteile verkehrt, werden sie jedoch zu sarkastischen Allegorien sozialer und politischer Phänomene in Russland.
Am Ende der Ausstellung wirft der Video-Film Perestroika-Songspiel. The Victory over the Coup (2008) einen Blick zurück zu dem historischen Moment des Volksaufstandes und des triumphalen Sieges der demokratischen Bewegung über die konservative Gegenbewegung im August 1991. Obwohl die Zeit der Perestroika voller Träume und Handlungen für eine neue Gesellschaft war, werden die Erfahrungen aus heutiger Sicht geschildert.
Das Projekt wird realisiert von Nikolay Oleinikov, Tsaplya (Olga Egorova), Glucklya (Natalia Pershina) und Dmitry Vilensky. Chto Delat? sind: Olga Egorova/Tsaplya (Künstlerin, Sankt Petersburg), Artiom Magun (Philosoph, Sankt Petersburg), Nikolai Oleinikov (Künstler, Moskau), Natalia Pershina/Glucklya (Künstler, Sankt Petersburg), Alexei Penzin (Philosoph, Moskau), David Riff (Kunstkritiker, Moskau), Alexander Skidan (Dichter, Kritiker, Sankt Petersburg), Kirill Shuvalov (Künstler, Sankt Petersburg), Oxana Timofeeva (Philosophin, Moskau) und Dmitry Vilensky (Künstler, Sankt Petersburg).
Das Kollektiv nahm bereits an Gruppenausstellungen in zahlreichen internationalen Institutionen wie dem New Museum, New York (2011), der 17. Biennale in Sydney (2010), bei Principio Potosí, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2010), der Istanbul Biennale (2009) und dem NBK – Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2009) teil. Einzelausstellungen waren u.a. Study, Study and Act Again, Moderna galerija, Ljubjana (2011), Between Tragedy and Farce, SMART project space, Amsterdam (2011), The Urgent Need to Struggle, ICA, London (2010) und Chto Delat?, ar/ge kunst, Bolzano (2010). Im Oktober 2011 wird Chto Delat? in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden zeigen.
Die Ausstellung wurde von der Robert Bosch Stipendiatin Anastasia Marukhina kuratiert.
Künstlergespräch
Sa. 27.08.2011, 16 Uhr
Anastasia Marukhina und Heike Ander (GLASMOOG) im Gespräch mit Dmitry Vilensky und Olga Egorova/Tsaplya
Aula der Kunsthochschule für Medien Köln
Filzengraben 2, Köln
http://glasmoog.khm.deIm Anschluss wird die Ausstellung Museum Songspiel von Chto Delat? in GLASMOOG eröffnet.
Die Ausstellung zeigt die jüngste Videoarbeit von Chto Delat?. Museum Songspiel erzählt die Geschichte einer Gruppe illegaler Einwanderer, die Zuflucht in einem Museum suchen, um der Ausweisung durch die Behörden zu entgehen.Die Chto Delat? Zeitung, die anlässlich der Ausstellung unter dem Titel Theatre of accomplices erscheint, wird in Kooperation mit GLASMOOG und mit der Unterstützung von Encuentro Internacional de Medellín (MDE11) produziert. Mitwirkende Autoren sind Luis Garcia, Mladen Dolar, Fernanda Carvajal, Keti Chukhrov, Katja Praznik, Ultra red; Online-Texte von general intellect.
Die Ausstellung ist eine Kooperation mit GLASMOOG an der Kunsthochschule für Medien Köln und wird unterstützt von der Robert Bosch Stiftung, der European Cultural Foundation, Filmclub 813 und Koellefolien.

Chto Delat?, Chronicles of Perestroika 2008, Videostill 
Chto Delat?, Perestroika Songspiel 2008, Videostill 
Chto Delat?, Russischer Wald, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Shrutti Garg 
Chto Delat?, Russischer Wald, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Shrutti Garg 
Chto Delat?, The Tower A Songspiel 2010, Foto: Shrutti Garg
-
Einzelausstellung: Stephen Prina – He was but a bad translation, 11.6. – 24.7.2011


Stephen Prina, He was but a bad translation, Blind No.9, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel Eröffnung am 10.06.2011, 19 Uhr
“Honey Suckle – A Color for All Seasons. Courageous. Confident. Vital. A brave new color, for a brave new world. Let the bold spirit of Honeysuckle infuse you, lift you and carry you through the year. It’s a color for every day – with nothing “everyday” about it.” (www.pantone.com)
Stephen Prinas Ausstellung im Kölnischen Kunstverein wird das gesamte Gebäude des Fünfziger Jahre Architekten Wilhelm Riphahn in Anspruch nehmen. Neben einer raumgreifenden Installation und Werken, die seiner Auseinandersetzung mit der Malerei entspringen, wird er Arbeiten aus seinem Zyklus The Way He Always Wanted It präsentieren. Dazu gehört ein 35mm-Film und eine Videoinstallation, in deren Mittelpunkt das Ford House, Aurora, Illinois des amerikanischen Architekten, Malers und Komponisten Bruce Goff steht, vor allen Dingen aber auch eine Performance, die in Kooperation mit Studenten der Hochschule für Musik und Tanz Köln und dem Institut für Neue Musik erstmalig in Köln realisiert wird. Für die Performance wird im Theatersaal des Kunstvereins das ständige Brummen eines chromatischen Totals zu vernehmen sein. Dazu wird nach den Vorgaben Prinas an ausgewählten Terminen eine Stunde lang ein Duo mit unterschiedlichen Instrumenten ein Lied spielen, das auf einer Komposition Goffs für ein automatisches Klavier basiert.
Übersetzungsprozesse zwischen verschiedenen künstlerischen Disziplinen sind ein Kernmotiv des amerikanischen Künstlers, der in seiner Arbeit auf Künstler, Architekten, Komponisten oder Filmemachern der Moderne und Popkultur verweist. Er kalkuliert mit den Missverständnissen und Enttäuschungen, welche die fehlerhaften und unvollständigen Übersetzungsprozesse kultureller Codes beim Betrachter auslösen und involviert ihn gleichzeitig durch die Faszination für visuelle Details und präzise räumliche Setzungen. Wie der Titel He was but a bad translation. bereits andeutet, bezieht er sich als Künstler in dieses Spiel mit ein.
Aufgrund seiner Weiterentwicklung konzeptueller und popkultureller Arbeitsweisen ist Stephen Prina bereits seit den Achtziger Jahren ein Impuls gebender Künstler für die internationale Kunstszene, insbesondere aber auch für Köln, wo er nun erstmals mit einer institutionellen Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein gewürdigt wird. Stephen Prina wurde 1954 in Galesburg, Illinois geboren. Er lebt und arbeitet in Cambridge, Massachusetts und Los Angeles.
Tägliche Filmvorführung, Kino in der Brücke, 16.30 Uhr
Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln und dem Institut für Neue Musik
Konzert
Stephen Prina und das Ensemble Garage
Concerto for Modern, Movie, and Pop Music for Ten Instruments and Voice
Europapremiere, Weltpremiere der überarbeiteten Version, 2011
Mi. 29.06.2011, 20 Uhr
Kooperation mit ON – Neue Musik KölnStephen Prinas Concerto for Modern, Movie and Pop Music for Ten Instruments and Voice wird er gemeinsam mit dem Ensemble Garage einmalig im Theatersaal des Kölnischen Kunstvereins präsentieren.
Prina hat neben seiner künstlerischen Laufbahn auch eine Ausbildung als Musiker genossen und spielt seit den Neunziger Jahren bei der experimentellen Popmusikband The Red Krayola. Das Konzert für zehn Instrumente und Gesang, das 2010 in St. Louis uraufgeführt wurde, basiert auf dem Concerto OP24 von Anton Webern, wobei die einzelnen Sätze des Konzerts von Pop Songs und Kompositionen Prinas unterbrochen werden. Er selbst singt und spielt Gitarre.
Das aus Studenten und Absolventen der Hochschule für Musik und Tanz Köln bestehende Ensemble Garage wurde 2009 von Brigitta Muntendorf und Rodrigo López Klingenfuss gegründet. Der Schwerpunkt des Ensembles liegt in der Zusammenarbeit mit den Interpreten, sowie der Aufführung eigener Kompositionen und solcher anderer junger Komponisten/innen. Projekte realisierte das junge Ensemble bislang für ON – Neue Musik Köln, die KGNM, den Landesmusikrat NRW, die Kölner Musiknacht und viele andere.Wir danken für die großzügige Förderung vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Stephen Prina, He was but a bad translation, Blind No.9, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen Prina, He was but a bad translation, Exquisite Corpse, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen Prina, He was but a bad translation, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen Prina, He was but a bad translation, The Way He Always Wanted It II, KöInischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Stephen Prina, Konzert am 29.06.2011
-
Ausstellung: Bela Kolarova & Lucie Stahl, 14.4. – 29.5.2011

in Kooperation mit der Stadtgalerie Schwaz
Eröffnung am 13.04.2011, 19 Uhr
Zur Art Cologne präsentiert der Kölnische Kunstverein eine Ausstellung von den beiden Künstlerinnen Bela Kolarova (1923-2010) und Lucie Stahl (*1977). Seit den frühen 1960er Jahren experimentierte Bela Kolarova in Prag mit fotografischen Techniken. In ihren Fotogrammen und Röntgenogrammen entwickelte sie im Anschluss an Künstler des Surrealismus und des Bauhaus die Fotografie als abstraktes Medium weiter. Sie arbeitete beispielsweise mit „künstlichen Negativen.“ Dafür presste sie natürliche Stoffe und Lebensmittel in Paraffin und benutzte sie bei der Belichtung des Fotopapiers unmittelbar als Negativ. Mit dieser Arbeitsweise ging sie in keiner Weise mit dem ästhetischen Kanon des sozialistischen Realismus konform, so dass sie relativ isoliert eine bemerkenswerte konzeptuelle und feministische Formensprache entwickelte. Ihre späteren Materialassemblagen aus eigenen Haar, Make-up und Schreib- und Haushaltsobjekten könnte man als serielle Objektbilder bezeichnen. Kolarova deckt darin bildimmanent und auf sehr persönliche Art und Weise weibliche Rollenmuster auf. Auch wenn Bela Kolarova als Person im Umfeld der avantgardistischen Prager Kunstszene international vernetzt war, ist ihr Werk erst in den letzten Jahren auf der documenta 12 (2007), bei Raven Row, in London (2010) und in Einzelausstellungen im Museum Kampa, in Prag (2008) und im Muzeum Umìní, in Olomouc (2007) gewürdigt worden.
Die Arbeiten von Bela Kolárová werden in der Ausstellung dialogisch mit den aktuellen Arbeiten von Lucie Stahl gezeigt, die trotz des zeitlichen Abstands und der unterschiedlichen Produktionsbedingungen formale Ähnlichkeiten aufweisen. Lucie Stahl bedient sich in ihren Plakatbildern eines zeitgenössischen fotografischen Verfahrens: Sie arrangiert scheinbar zufällig Alltagsobjekte, wie beispielsweise Gewürze, Flüssigkeiten, Krawatten, Frauenmagazine oder Autoreifenfelgen auf einem Scanner und gießt den daraus resultierenden Inkjet-Print wie ein distanziertes Objekt in Polyurethan ein. In ihren dazu verfassten selbstironischen Kurzkommentaren offenbart sie nicht nur auf humorvolle Weise ihre subjektiven Beobachtungen gesellschaftlicher und politischer Ereignisse, sondern gibt auch offen Einsicht in den Wettbewerb unter Künstlerkollegen oder die Hysterie, die der künstlerischen Produktion unterliegt.
Lucie Stahl lebt in Wien. Sie wird vertreten von Dépendance, Brüssel und Galerie Meyer Kainer, Wien. Ihre Arbeiten zeigte sie in Einzelausstellungen im Kunstverein Nürnberg (2009) in der Dépendance, Brüssel (2005 und 2008), der Galerie Michael Neff, Frankfurt (2007) und im Flaca, London (2005). Darüber hinaus stellte sie unter anderem in der Temporary Gallery, Köln (2009), bei Croy Nielsen, Berlin (2008), und im kjubh Köln (2004) aus. Gemeinsam mit Will Benedict leitet sie den Wiener Ausstellungsraum Pro Choice. Parallel zur Ausstellung erscheint ein Künstlerbuch von Lucie Stahl. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Stadtgalerie Schwaz.
Die Ausstellung von Bela Kolarova und Lucie Stahl wird gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, den Schroubek Fonds, München und die Karin Abt-Straubinger Stiftung. Dank auch an die Sammlung Seilern, Wien, den Werkladen Köln, Artex Art Services, Ulrike Remde, Kurt und Claudia von Storch, Koellefolien und den Filmclub 813.
-
Einzelausstellung: Der Springende Punkt: Claus Richter – Millions of Lights, 14.4. – 20.5.2011

Archivreihe
Eröffnung: 13.04.2011, 19 Uhr
Pinke Walt-Disney Dornröschenschlösser im Miniaturformat, Dörfer aus Polly Pocket-Häuschen, Sahnetorten aus Plastik, Masken und Laserschwerter, Fotografien von Abenteuer- und Phantasylandschaften in Themeparks – In unserem diesjährigen Archivprojekt Millions of Lights wird Claus Richter sein eigenes Archiv von Spielzeugen und Unterhaltungsartikeln und Fotos durchforsten und selbst einen kleinen Theme-Park errichten, der einen sehr speziellen Blick in die verlockenden Welten von Disneyland, Phantasialand und die Studios von Hollywood eröffnet.
Millions of Lights dreht sich um Eskapismus, um Weltflucht. Aus den präsentierten Materialien werden nicht nur historische Parallelen zwischen Kunst- und Unterhaltungswelten deutlich, vielmehr offenbaren sie bei genauer Beobachtung ein sehr deutliches Bild von der Konstruktion unserer Welt.
Claus Richter (*1971) präsentierte jüngst eine große Einzelausstellung im Leopold-Hoesch-Museum in Düren. Einzelausstellungen hatte er auch im Kunstverein Braunschweig (2008), in der Ursula Blickle Stiftung in Kraichtal, im Museum für Gegenwartskunst in Siegen (2005) und in der Galerie Clages und Eva Winkeler in Köln. Im Kölnischen Kunstverein zeigte er 2009 in der Ausstellung Après Crépuscule und ist seitdem Atelierstipendiat des Kölnischen Kunstvereins und der Imhoff Stiftung. Die Ausstellung ist Teil der Reihe Antenne Köln.
Führungen durch das Archivprojekt
Fr. 29.04.2011, 17 Uhr
Fr. 13.05.2011, 17 Uhr
So. 15.05.2011, 11 Uhr (Familienführung Internationaler Museumstag)Lecture Performance
Weltfluchten von Claus Richter
Mi 18.05.2011, 20 UhrClaus Richter wird gefördert durch die Imhoff Stiftung und den Kopierladen Print und Copy Center, Köln.

Ausstellungsansichten Happening und Fluxus“ in der Archivreihe „Der springende Punkt, präsentiert von Marcel Odenbach, 2007, Fotos: Michael Strassburger 
Ausstellungsansichten Happening und Fluxus“ in der Archivreihe „Der springende Punkt, präsentiert von Marcel Odenbach, 2007, Fotos: Michael Strassburger 
Claus Richter, Millions of Lights, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Claus Richter, Millions of Lights, Kölnischer Kunstverein 2011, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Kerstin Brätsch und DAS INSTITUT – „Nichts, Nichts!”, 5.2. – 20.3.2011

„»Nichts, nichts! Und zehn Jahre Arbeit!«
Er setzte sich und schluchzte!“Der Maler Frenhofer in Honoré de Balzacs berühmter Erzählung “Das unbekannte Meisterwerk” (1831) ist erschüttert, als seine Künstlerkollegen sein gemaltes Portrait als unförmige, fleischige Masse wahrnehmen. Kerstin Brätsch antwortet im Titel der Ausstellung („Nichts, Nichts!“) auf Frenhofers hysterischen Ausbruch und inszeniert sich als seine künstlerische Antipodin. Ihre großformatigen Malereien auf Papier werfen Fragen zur künstlerischen Persona oder gar der Marke „Kerstin Brätsch“ auf. Seit 2007 betreibt sie gemeinsam mit Adele Röder DAS INSTITUT als Agentur für Import und Export. DAS INSTITUT bietet Serviceleistungen an und übernimmt die Werbung und Distribution der eigenen Kunstwerke.
Brätsch und Röder imitieren die Verwertungsmechanismen von Unternehmen und schleusen ihre Werke wie Vorlagen und Muster in eine selbst gewählte Produktionskette ein. Erstmals präsentieren Kerstin Brätsch & DAS INSTITUT in Köln neben Gemälden ihre erste Modekollektion: Digital gestrickte Hosenanzüge – maßgeschneidert auf die Modelle Röder und Brätsch – und Parasite Patches, die per Druckknopf an vorhandene Kleidung angebracht werden können und auf den Motiven ihrer Poster basieren.
Das, was wie eine starke Übertreibung ausschaut, die den schmalen Grat zwischen Kunst, Strickmode, Rollenspiel und industrieller Produktion betritt, entpuppt sich gleichzeitig als eine pointierte Beobachtung des Kunstbetriebs und ein Plädoyer für die Malerei und ihre Möglichkeiten.
Kerstin Brätsch, geboren 1979 in Hamburg, lebt und arbeitet zurzeit in New York. Zuletzt zeigte sie ihre Arbeiten im Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux (2010), auf dem Art Statement der Galerie BaliceHertling, Art Basel (2010) und im Projektraum Hermes und der Pfau, Stuttgart (2009).
Erste internationale Aufmerksamkeit erhielt DAS INSTITUT mit seiner Ausstellung im Swiss Institute, New York (2009) und Ausstellungsbeteiligungen im New Museum, New York (2009) undim PS1/ MoMA , New York (2010). Im Sommer erscheint ein Künstlerbuch, gemeinschaftlich produziert von Kölnischer Kunstverein, Parc Saint Léger und Kunsthalle Zürich.

DAS INSTITUT, BuyBrätschWörst 2010, Foto: Viola Yesiltac 
Kerstin Brätsch und DAS INSTITUT, Austellungsansicht, Foto: Simon Vogel 
Kerstin Brätsch und DAS INSTITUT, Austellungsansicht, Foto: Simon Vogel 
Kerstin Brätsch und DAS INSTITUT, Austellungsansicht, Foto: Simon Vogel 
Kerstin Brätsch und DAS INSTITUT, Austellungsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Verbotene Liebe – Kunst im Sog von Fernsehen, 25.9. – 19.12.2010

Mit Beiträgen von Judith Barry, Joseph Beuys, Paul Chan, Mel Chin and the GALA Committee, Jaime Davidovich, Simon Denny, Kalup Linzy, Christoph Schlingensief, Ryan Trecartin, Francesco Vezzoli, Andy Warhol.
Angesichts der Tatsache, dass Fernsehen mit zunehmender Selbstverständlichkeit unser Denken und Handeln bestimmt, dass es zu den Dingen gehört, die wir vor lauter Gewohnheit nicht mehr reflektieren, erscheint es sinnvoll, den “alten Kasten” noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Verbotene Liebe: Kunst im Sog von Fernsehen beobachtet die Verführungsmethoden des Fernsehens, mit ihren “grellen Manierismen” und beschreibt Fernsehen als Erlebniswelt mit unterschiedlichsten Formaten und Kommunikationsformen und den darin enthaltenen Doppeldeutigkeiten. Das Projekt zielt nicht auf eine inhaltliche oder moralische Analyse des Fernsehens, sondern interessiert sich für eine ästhetische, eine “campe” Betrachtungsweise dieses Feldes, wie Susan Sontag sie in ihren Anmerkungen zu Camp beschrieben hat.
Nach dem Vorbild Andy Warhols nutzen die Künstler der Ausstellung die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie für sich. Selbst mit Fernsehen aufgewachsen, nähern sie sich dem Medium aus der Position hoch spezialisierter Zuschauer. Sie folgen ihrer Faszination für das Künstliche, für das Scheitern der Ernsthaftigkeit, für die Stilblüten der Selbstdarstellung, den staubigen Glanz der Oberflächen. Kalup Linzy, Ryan Trecartin oder Francesco Vezzoli greifen in ihren Arbeiten Formate wie die Soap, die Castingshow oder Werbung auf. In dem kindlichen Rollenspiel, der überzogenen Selbstdarstellung werden die ambivalenten Mechanismen des Fernsehens, die Ausschlussmechanismen und Erwartungshaltungen besonders deutlich. Um diesen Betrachtungsweisen von Fernsehen einen Ausstellungsrahmen zu geben, hat Simon Denny ein Setting entwickelt, das der Komplexität der Beziehungen zum Konsumobjekt Fernsehen und seinen Bildern Rechnung trägt.
Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein wurde von Simon Denny, Kathrin Jentjens und Anja Nathan-Dorn konzipiert. Simon Denny ist Atelierstipendiat des Kölnischen Kunstvereins und der RheinEnergie Stiftung Kultur in der Brücke.
Projektpartner für Verbotene Liebe: Kunst im Sog von Fernsehen/Forbidden Love: Art in the Wake of Television Camp sind der Kunstverein Medienturm, Graz und Brainpool.
Der Kölnische Kunstverein wird gefördert durch Stadt Köln und koellefolien.
Partner des Kölnischen Kunstvereins 2010: Kunststiftung NRW.
Herzlicher Dank an Filmclub 813, Thorsten Koch, Robert Müller-Grünow und Wilhelm Schürmann.

Verbotene Liebe – Kunst im Sog von Fernsehen, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Verbotene Liebe – Kunst im Sog von Fernsehen, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Verbotene Liebe – Kunst im Sog von Fernsehen, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Verbotene Liebe – Kunst im Sog von Fernsehen, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: DIE LETZTEN IHRER ART – Eine Reise zu den Dinosauriern des Kunstbetriebs, 26.6. – 5.9.2010

Kooperation der Kunstvereine Düsseldorf – Köln – Bonn
Erstmalig haben die Kunstvereine Bonn, Düsseldorf und Köln ein gemeinschaftliches Veranstaltungs- und Katalogprojekt erarbeitet, in dem die institutionellen Herausforderungen für Kunstvereine im 21. Jahrhundert diskutiert werden sollen. Kunstvereine sind in ihrem Kern bürgerliche Institutionen, die sich im Vormärz des 19. Jahrhunderts als engagierte Antwort auf die adeligen Salons entwickelt haben. Was passiert aber, wenn wir feststellen, dass in unserer postbürgerlichen Gesellschaft Vereinskultur, bürgerliches Engagement und föderale Logiken einen Bedeutungsverlust erleben, und wie wirkt sich dies auf Kunstvereine aus?
In Anspielung auf Douglas Adams’ Reisebericht „Die Letzten ihrer Art“ stellen wir Kunstvereine als eine vielleicht bedrohte, aber auch besondere und sehr erhaltenswerte Spezies vor und nehmen sie in verschiedenen Veranstaltungen in Bonn, Köln und Düsseldorf unter die Lupe.
Ausstellungen:
Bonner Kunstverein
26. Juni – 29. August 2010
ALTRUISMUS: KUNST AUS TSCHECHIEN HEUTE
in Kooperation mit tranzit, Prag
Freitag, 25. Juni, 19.45 Uhr EröffnungKölnischer Kunstverein
26. Juni – 5. September 2010
MELANIE GILLIGAN
in Kooperation mit Chisenhale Gallery, London
Freitag, 25. Juni, 19 Uhr EröffnungKunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
26. Juni – 22. August 2010
HENRIK PLENGE JAKOBSEN
in Kooperation mit Overgaden, Kopenhagen
Freitag, 25. Juni, 19.30 Uhr EröffnungBegleitprogramm:
Freitag, 25. Juni, ab 22 Uhr
gemeinsame Party im Kölnischen Kunstverein, Die Brücke, Hahnenstraße 6, 50667 Köln. Musik mit CHRISTIAN NAUJOKS.Sonntag, 27. Juni, 12 Uhr, Ort: Kölnischer Kunstverein, Theatersaal
Subjekt und Gesellschaft
Künstlergespräch mit MELANIE GILLIGAN
Polly Staple, Direktorin der Chisenhale Gallery, London, wird mit MELANIE GILLIGAN über die Hintergründe der neuen Filmproduktion „Popular Unrest“ sprechen und sie zu ihrer Arbeitsweise und die Zusammenarbeit mit den zwölf beteiligten Hauptdarstellern befragen. Es wird dabei genauso um MELANIE GILLIGANs Überlegungen zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und zur Ökonomisierung sozialer Beziehungen gehen, wie um ihre Inspiration durch das Fernsehen.Mittwoch, 30. Juni, 19 Uhr, Ort: Bonner Kunstverein
Altruismus als Arbeitsprinzip für unabhängige Kunstinstitutionen in Tschechien
Ausstellungsführung und Gespräch mit Stephan Strsembski und Noemi Smolik Stephan Strsembski, Kurator der Ausstellung, und Noemi Smolik, Kunstkritikerin und Kennerin der tschechischen Kunstszene, führen durch die Ausstellung ALTRUISMUS und diskutieren über die Situation unabhängiger Kunstinstitutionen in der Tschechischen Republik, über ihre Entstehungsgeschichten und ihre Arbeitsweisen im Vergleich zu Kunstvereinen im deutschsprachigen Raum.Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr, Ort: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
Andere Länder, andere Institutionen.
Gespräch mit Henriette Bretton-Meyer
Kunstvereine gibt es nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie sehen vergleichbare Institutionen im restlichen Europa aus? Und was zeichnet einen Kunstverein aus der Perspektive jener aus, die dieses Modell nur aus der Distanz kennen? Henriette Bretton-Meyer, Direktorin von Overgaden in Kopenhagen, diskutiert mit Vanessa Joan Müller, Direktorin Kunstverein DüsseldorfMittwoch, 7. Juli, 19 Uhr, Ort: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
Kunstverein: heute, morgen, gestern
Gespräch mit Wulf Herzogenrath und Florian Waldvogel
Prof. Wulf Herzogenrath, Direktor der Kunsthalle Bremen, und Florian Waldvogel, Direktor des Kunstvereins in Hamburg, diskutieren über aktuelle Perspektiven der Institution Kunstverein, produktive Krisen der Vergangenheit und Modelle für morgen.Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, Ort: Kölnischer Kunstverein, Theatersaal
Bürgerschaftliches Engagement als Weg aus der Krise
Gespräch mit Loring Sittler, Zukunftsfonds der Generali Deutschland
Der Zukunftsfonds der Generali Deutschland widmet sich der Förderung bürgerschaftlichen Engagements und konzentriert sich mit Blick auf den demografischen Wandel insbesondere auf das Engagement älterer Menschen. Loring Sittler wird im Gespräch darlegen, inwiefern diese Ausrichtung eine Antwort auf die aktuelle Transformation der Aufgaben im Bereich von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sein kann und den Engagementatlas 09 vorstellen. -
Einzelausstellung: Melanie Gilligan, 26.6. – 5.9.2010

Melanie Gilligan, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung im Kölnischen Kunstverein 2010, Design: Manuel Raeder Einzelausstellung im Rahmen von Die Letzten ihrer Art
„Of course you’re special, special like everyone else.“
Melanie Gilligan, Popular Unrest, 2010Melanie Gilligan greift in ihren Arbeiten verschiedene Medien und Genre auf wie Video, Performance, Text, Installationen und Musik. Ihr neuer Film Popular Unrest ist ein Episodendrama, das in einer unserer Gegenwart sehr ähnlichen Zukunft spielt. Dort allerdings werden alle Transaktionen und sozialen Interaktionen durch ein System, mit dem Namen the Spirit, überwacht. So geschehen rund um die Welt eine Anzahl unerklärlicher Morde, die häufig in der Öffentlichkeit verübt werden, dennoch sehen Zeugen nie einen Angreifer. Auf ebenso mysteriöse Weise versammeln sich plötzlich überall Menschen, die zuvor in keinerlei Beziehung zueinander standen. In den neuen Gruppierungen finden schnell immer mehr Menschen zusammen, die unerklärlicherweise eine tiefe und beständige Verbindung zueinander empfinden.
Der Film erkundet eine Welt, in der das Selbst auf seine physische Seite reduziert und unmittelbar den Anforderungen des Kapitals unterworfen ist. Hier bieten Hotels Bedienstete zum Vorwärmen der Betten an. Menschen werden bestraft, weil sie sich nicht gegen vorhersehbare Krankheiten geschützt haben. Lebensmittel, die das Gewicht kontrollieren sollen, tun das indem sie den Verdauenden von innen verzehren und Arbeitslose zahlen der Gesellschaft ihre Schulden in Körperenergie zurück. Wenn dies einerseits auf die vollständige Dominanz von Tauschwerten über das Leben hinweist, bieten dann die neuen Gruppierungen einen Ausweg?
Der Film wurde in London mit einer Besetzung von zwölf Hauptdarstellern gedreht. Seine Form wurde einerseits durch David Cronenbergs so genannten „Body Horror“ inspiriert und andererseits durch amerikanische Krimiserien wie CSI, Dexter und Bones, in denen Körperlichkeit mit psychologischen Aspekten des Horrors verbunden wird.
Die fünf Episoden des Films werden in der Ausstellungshalle des Kölnischen Kunstvereins jeweils einzeln gezeigt. Wie auch in ihren letzten Videoarbeiten orientiert sich Gilligan mit der episodischen Struktur ihres Films am Medium Fernsehen. Auf einer eigenen Website sind die Filmepisoden ebenfalls zugänglich.Im Kino zeigt Gilligan zwei weitere Filme, die thematisch an die neue Produktion anschließen. In dem vierteiligen Film Crisis in the Credit System (2008) erzählt Gilligan in einem fiktiven Drama von einer großen Investmentbank, die ihre Angestellten zu einer Sitzung einlädt, um Strategien für den Weg aus der Finanzkrise zu entwickeln. In dem Single-Screen-Film Self-capital (2009) wird der Kapitalismus als eine Person dargestellt, die sich einer Therapie unterzieht.
Der Film Popular Unrest wurde gemeinschaftlich von der Chisenhale Gallery, London, dem Kölnischen Kunstverein, der Presentation House Gallery, North Vancouver und der Walter Philipps Gallery, The Banff Centre, Banff produziert sowie von der Galleria Franco Soffiantinto, Turin, dem Kulturamt der Stadt Köln, der Stanley Thomas Johnson Stiftung und der Rheinland AG unterstützt.
Melanie Gilligan, 1979 in Toronto geboren, lebt und arbeitet derzeit in London und New York. Gilligan schloss 2002 den Bachelor (Hons) Fine Art am Central Saint Martins College, London ab und war 2004-2005 Stipendiatin des Independent Study Programme am Whitney Museum of American Art, New York. Zuletzt stellte sie als Teil des Glasgow International Festival in der Transmission Gallery, Glasgow (2008) und in der Galleria Franco Soffiantinto, Turin (2009) aus. Im Oktober 2009 erhielt Gilligan den Paul Hamlyn Award for Artists.
-
Einzelausstellung: Alexandra Bircken – Blondie, 22.4. – 6.6.2010


Alexandra Bircken, Ankündigung zur Ausstellung Blondie im Kölnischen Kunstverein 2010, Design: Manuel Raeder Zur Art Cologne präsentiert der Kölnische Kunstverein mit Alexandra Bircken (geboren 1967) eine außergewöhnliche Kölner Künstlerin, die zurzeit international große Aufmerksamkeit erfährt. Als ehemalige Atelierstipendiatin (2004-2008) begleitet der Kölnische Kunstverein die Künstlerin seit Beginn ihrer künstlerischen Arbeit.
Alexandra Bircken hat in den letzten Jahren eine eigenwillige skulpturale Sprache entwickelt, die ein großes Materialverständnis und eine Sensibilität im Umgang mit natürlichen und künstlichen Stoffen verrät. Ihre Skulpturen spielen mit dem Verhältnis von Kunst und Handwerk. Handwerkliche Arbeitsweisen werden von ihr aufgegriffen und über Verweise zu Mode und Konsumkultur in einen popkulturellen Zusammenhang übertragen.
Angefangen mit kleinen Strickobjekten, die sich von jeglicher Funktion befreit haben und sich in eigenständige kleine Wesen verwandelt haben, arbeitet sie mit unterschiedlichsten Materialien wie Wolle, Ästen, Beton, Steinen. Sie entwickelt daraus freistehende Skulpturen, hängende Objekte oder Wandarbeiten, in denen das Moment der Transformation eines funktionalen Gegenstandes in ein ästhetisches Objekt oder in einen narrativen Mikrokosmos zentral ist.
Alexandra Bircken studierte Modedesign am Londoner St. Martins College, wo sie auch unterrichtete, bevor sie ihre ersten Einzelausstellungen in der Galerie BQ in Köln hatte. Sie stellte in Einzelausstellungen im Stedelijk Museum CS in Amsterdam (2008), Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal (2008), Gladstone Gallery, New York (2007) und Herald Street, London (2005) aus. In Gruppenausstellungen war sie u. a. in der Barbican Art Gallery, London (2008), im New Museum, New York (2007), und bei White Columns, New York (2005) beteiligt.
Die Imhoff Stiftung fördert das Atelierprogramm und Alexandra Bircken seit 2004. Die RheinEnergie Stiftung Kultur unterstützt mit dem Programm „Antenne Köln“ seit 2007 den Kölnischen Kunstverein. Der Kölnische Kunstverein freut sich über die erneute Unterstützung der Einzelausstellung und Produktion neuer Arbeiten durch die beiden Kölner Stiftungen.

Alexandra Bircken, Blondie, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Alexandra Bircken, Blondie, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Alexandra Bircken, Blondie, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Alexandra Bircken, Blondie, Kölnischer Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: ars viva 09/10 – Geschichte/History, 20.2. – 4.4.2010

Eine Ausstellung der PreisträgerInnen Bildende Kunst des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., in Kooperation mit dem Museum Wiesbaden, dem Kölnischen Kunstverein und dem Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich.
Preisträger: Mariana Castillo Deball, Dani Gal, Jay Chung & Q Takeki MaedaEröffnung am 19.02.2010, 19 Uhr
Der Kölnische Kunstverein richtet in diesem Jahr den renommierten ars viva-Preises zum Thema Geschichte aus und stellt die jungen Preisträger Dani Gal, Mariana Castillo Deball und Jay Chung und Q Takeki Maeda der Öffentlichkeit vor. Es scheint gerade in der Wirtschaftskrise verlockend, sich über den historischen Rückblick Orientierung zu verschaffen.
Auffallend ist, dass sich alle ausgezeichneten Künstler mit ihrer Arbeit auf das historische Dokument konzentrieren, als wäre es der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich heutzutage noch einigen kann. Die Künstler schlüpfen in die Rolle von „Amateur-Archäologen“ und arbeiten mit Fundstücken und Fragmenten in einem assoziativen Spiel, das persönliche Begegnungen mitObjekten und Orten spiegelt.
Die Ausstellung wird partnerschaftlich mit dem Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft im BDI organisiert. Der Kölnische Kunstverein wurde neben dem Museum Wiesbaden und dem Migros Museum Zürich vom Kulturkreis zur Ausrichtung der Ausstellung eingeladen.

Jay Chung Q Takeki Maeda, Ohne Titel 2009, ars viva im Kölnischen Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Mariana Castillo Deball Do ut des 2009, The stronger the light 2010, ars viva im Kölnischen Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Dani Gal, Seasonal Unrest, ars viva im Kölnischen Kunstverein 2010, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Lecture Performance, 23.10. – 20.12.2009


Lecture Performance, Ankündigung zur Ausstellung im Kölnischen Kunstverein 2009. Design: Manuel Raeder Mit Fia Backström, Lutz Becker, Walter Benjamin, Pauline Boudry/Renate Lorenz, Andrea Fraser, Dan Graham, Achim Lengerer, Michael Lentz/Uli Winters, Xavier Le Roy, Robert Morris, Martha Rosler, TkH, V-Girls, Jeronimo Voss.
Lecture Performances sind ein aktuelles Phänomen der zeitgenössischen Kunst, das in den letzten Jahren zahlreiche Ausformulierungen erfahren hat. Künstler arbeiten in diesem relativ jungen Genre an der Schnittstelle von Vortrag und Performance und vermischen auf kreative Weise die Inszenierung der eigenen Person vor Publikum mit Methoden der klassischen Kunstvermittlung.
Dabei reagieren sie in ihren Arbeiten auf das aktuelle Kunstsystem, dessen Grenzen zwischen Produktion, Vermittlung und Kritik immer mehr verwischen.Diese selbstreflexive und diskursorientierte Praxis wird in der Ausstellung mit beispielhaften Arbeiten vorgestellt und in Dialog zu einzelnen Referenzarbeiten aus der amerikanischen Conceptual Art, der osteuropäischen Aktionskunst und der institutionellen Kritik gesetzt, die die Wurzeln dieses Verfahrens sichtbar machen. Dass Lecture Performances nicht nur ein Thema in der Bildenden Kunst sind, sondern auch in der Choreographie, der Literatur, der Musik und der Wissenschaft diskutiert werden, wird an den Arbeiten evident.
Die Ausstellung Lecture Performance ist ein partnerschaftliches Projekt mit dem Museum of Contemporary Art, Belgrad und findet in der Reihe Europäische Partnerschaften statt, gefördert durch die Kunststiftung NRW und das Goethe-Institut.
Für die Unterstützung danken wir auch Köllefolien. -
Ausstellung: Everything, then, passes between us, 27.6. – 23.8.2009

Mit Vito Acconci, Johanna Billing, Olga Chernysheva, Song Dong, Anja Kirschner, Klara Lidén, Improv Everywhere, Cinthia Marcelle, Marjetica Potrc, Christine Schulz, Alex Villar, Haegue Yang. Kuratiert von Christine Nippe.
Die Ausstellung Everything, then, passes between us zeigt Momentaufnahmen des Urbanen und fragt danach, wie Formen der Öffentlichkeit oder der temporären Vergemeinschaftung heute gefasst und hergestellt werden können. Die Künstler/innen greifen das Fragmentarische der Metropolen in der globalen Umbruchsituation auf. Sie fragen nach aktuellen Vorstellungen von Community und Vergesellschaftung in der Stadt.
Die von Christine Nippe kuratierte Schau zeigt mit dem Fokus auf künstlerische Interventionen und Performances in globalen Metropolen wie Beijing, Belo Horizonte, Berlin, Köln, London, New York und Seoul die “Großstadt und ihr Geistesleben”, nur eben mehr als hundert Jahre nach Georg Simmels berühmtem Essay zur Mentalität der Metropolenbewohner um die Jahrhundertwende.
Everything, then, passes betweeen us wird freundlicherweise unterstützt durch Köllefolien.
Marjetica Potrc, Rural Practices, Future Strategies, 2007. Marjetica Potrc New Orleans Rainwater Connections, 20072009. Everything, then, passes between us, Kölnischer Kunstverein 2009, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Anja Kirschner, Polly II, 2006, Everything, then, passes between us, Kölnischer Kunstverein 2009, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Christine Schulz, Everything, then, passes between us, Kölnischer Kunstverein 2009, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Nora Schultz – 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 23.4. – 7.6.2009


Nora Schultz, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung im Kölnischen Kunstverein 2009. In Nora Schultz’ (*1975) erster institutioneller Einzelausstellung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 zeigt sie umfassende Installationen, Diaprojektionen und Filme, die ihre intensive Auseinandersetzung mit einer konkreten Realität auf abstrakte Weise formulieren. Ihre unmittelbare Sprache und die Thematisierung kultureller, politischer und ethnographischer Werte durchdringen sich dabei gegenseitig.
Nora Schultz hat für den Ausstellungsraum eine Installation geschaffen, die grundlegende skulpturale Fragen aufgreift. Zu sehen sind mehrere an der Wand montierte oder mit einem Seil abgehängte, verchromte Rohre, die gleich einem Mobile sich mal in perfekter Balance befinden und an Waagen erinnern und mal ihr Gleichgewicht verloren haben und mit ihrer eigenen Haltung kämpfen.
Die fragilen Skulpturen werden im hinteren Bereich des Raums um zwei Diaprojektionen erweitert. Die erste Diaserie hält dreidimensionale Objekte mittels der zweidimensionalen Photographie aus unterschiedlichsten Winkeln fest. In der Bildfolge werden sie damit aber letztlich dynamisiert und in Bewegung gesetzt. Im letzten Raum empfängt den Besucher eine weitere Diaprojektion mit gefundenen und persönlichen Bildern von Reisen.
Die abstrakten Andeutungen eines (Un-)Gleichgewichts von Massen und Werten werden hier in weitgreifende kulturelle und politische Bilder übersetzt. Dabei stellt Schultz assoziative Bezüge zum französischen Schriftsteller und Ethnologen Michel Leiris her, der in seinen Reisebüchern und Essays eine schonungslose Selbstanalyse und einen offenen, unmittelbaren Eindruck seiner Erlebnisse fremder Kulturen schildert. In seinem Tagebuch L´Afrique Fantôme beschreibt er afrikanische Rituale, in denen Stammeskulturen nicht nur ihre eigene Geschichte reflektieren. In ihren Ritualen kommentieren und parodieren sie auch europäische Kulturen und zeigen, dass es nie nur den einen herrschenden Blick auf einen Gegenstand gibt, sondern dass dieser Blick durchaus zurückgeworfen wird.
Zur Ausstellung erscheint eine Publikation.
Nora Schultz, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, Kölnischer Kunstverein 2009. Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nora Schultz, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, Kölnischer Kunstverein 2009. Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Nora Schultz, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, Kölnischer Kunstverein 2009. Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Après Crépuscule, 7.2. – 5.4.2009

Gruppen- und Archivausstellung mit Beiträgen von J. Louis Again, Michael Bracewell, Enrico David, Devine & Griffiths, Christian Flamm, Julian Göthe, Benoit Hennebert, Julia Horstmann, Linder, Lucy McKenzie, Claus Richter, Hanna Schwarz, Claude Stassart, Lawrence Weiner, Detlef Weinrich, Denyse Willem.
Die kleine belgische Plattenfirma Les Disques du Crépuscule kreierte ein erstaunlich wirkungsvolles, zugleich kaum systematisch erschlossenes kulturelles Phänomen an den Rändern von Pop und High Art.
Im Zuge der popmusikalischen New Wave schuf das Label ab Beginn der 80er Jahre eine Identität aus aktueller Musik, Covertexten und einer einzigartigen optischen Präsentation. Chefdesigner Benoit Hennebert und seine Kollegen gestalteten einen flirrenden Stil aus dem Spiel mit Ideen der frühen Moderne, alten Werbegraphiken und dem Comicstil der „Ligne Claire“.
Einen musikalischen Einfluss der über begrenzte Szenen hinaus reichte, hatte das Label Œuvre allein in Japan. Und obwohl für Les Disques du Crépuscule Künstler wie Lawrence Weiner, Linder oder Denyse Willem Arbeiten beisteuerten, kam es auch zu keiner engeren Anknüpfung an die Brüsseler Galerienszene der 1980er. Doch in den letzten Jahren beziehen sich zusehends Künstler wie Enrico David, Christian Flamm, Julia Horstmann, Lucy McKenzie, Claus Richter, Hanna Schwarz oder Detlef Weinrich in direkter Weise auf das Label, seine Musik und seine Graphik.
Dieser so spannenden, weil unmittelbaren und dennoch zumeist verborgenen, Wirkungsgeschichte gilt es nachzuforschen. Die Ausstellung ist dafür in zwei Teile gegliedert: In der Ausstellungshalle werden Arbeiten von Linder, Lawrence Weiner, Benoit Hennebert und anderen gezeigt, die zur aktiven Zeit des Labels entstanden, sowie Arbeiten junger internationalen Künstler, welche sich in ihrer aktuellen Perspektive mit dem Label beschäftigen. Im Seminarraum im dritten Geschoss werden dem Besucher zur tätigen Vertiefung weitere historische Dokumente, Archivmaterialien, Fotos, Videos und Musik angeboten.

Aprés Crépuscule, Kölnischer Kunstverein 2009, Ausstellunsansicht, Foto: Simon Vogel 
Aprés Crépuscule, Kölnischer Kunstverein 2009, Ausstellunsansicht, Foto: Simon Vogel 
Aprés Crépuscule, Kölnischer Kunstverein 2009, Ausstellunsansicht, Foto: Simon Vogel 
Aprés Crépuscule, Kölnischer Kunstverein 2009, Ausstellunsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Seth Price, 14.11.2008 – 4.1.2009


Seth Price, Köln WavesBlues, 2005–2008, Kölnischer Kunstverein 2008, Ausstellungsansicht, Foto: Simon Vogel Die „calendar paintings“ des US-amerikanischen Künstlers Seth Price (geb. 1973, lebt und arbeitet in New York) enthalten Bilder der wenig bekannten amerikanischen Malerei aus der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie veraltete Computergrafiken und Werbung aus Zeitschriften, die mit Inkjet auf Leinwände gedruckt wurden.
Diese Arbeiten, die in den Jahren 2003 und 2004 entstanden und nun erstmalig ausgestellt werden, bilden den Fokus der kommenden Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein. Seth Price präsentiert sie im Ausstellungsraum auf schwebenden Wandflächen. Der Künstler stellt den Gemälden Plastikreliefs zur Seite, die im industriellen Verpackungs-Tiefzugverfahren aus Polystyrol hergestellt werden. Die Reliefs zeigen Masken oder Gesichtsabdrücke und erscheinen wie hochglänzende, glamouröse Produkte. Sie wurden in verschiedenen Farben hergestellt und tragen das Datum ihrer Herstellung. Die Präsentation wird durch eine malerische Videoprojektion ergänzt, in der eine animierte Sequenz eines sich bewegenden schwarzen Meeres im Loop gezeigt wird.
Die atmosphärische Installation erzeugt den Eindruck einer Zeitreise, in der auf unterschiedliche Weise der Umgang und die Verwendung von Dingen, Objekten und Bildern vorgeführt wird. Price manipuliert gefundene Bilder, zeigt ihre Veränderlichkeit und Abhängigkeit von Präsentations- und Distributionsstrukturen und macht seine eigenen Manipulationen sichtbar. Die Reise eines Bildes vom Computerscreen zur Leinwand und vice versa wird plötzlich als eine schmale Gratwanderung erlebbar.
Die Ausstellung wird gefördert durch die WestLB.
-
Ausstellung: Der springende Punkt: Olivier Foulon – The Soliloquy of the Broom/Selbstgespräch eines Besens, 23. – 28.8.2008


Olivier Foulon, The Soliloquy of the BroomSelbstgespräch eines Besens, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung im Kölnischen Kunstverein 2008, Design: Manuel Räder in Zusammenarbeit mit Olivier Foulon Archivreihe
2. Obergeschoss
Der Titel der Ausstellung TheSoliloquy of theBroom/Selbstgespräch eines Besens des Künstlers Olivier Foulon (*Brüssel, 1976) schwebt zwischen Make-up, Maskerade und Malerei. Im Zentrum steht das Gemälde Jo, theBeautifulIrish Girl von Gustave Courbet, das der französische Maler 1865 in Trouville fertigte. Zu sehen ist eine Dame namens Jo, Geliebte und Modell des Künstlers James Whistler, die sich und ihr Haar im Spiegel betrachtet. Aufgrund großer Nachfrage kopierte Gustave Courbet dieses Bild mehrfach. Die vier Versionen befinden sich heute im Metropolitan Museum, New York, dem Nelson-Atkins Museum, Kansas City, dem Nationalmuseum, Stockholm und einer Privatsammlung. In einem 16mm-Film hat Olivier Foulon die vier Bilder zusammengeführt und arbeitet mit der Idee des ¨Modells als Vorlage für ein Gemälde, welches selbst zum Modell wird¨ und veranschaulicht mit diesem Projekt frühe Formen einer künstlerischen Massenproduktion.
Eine Publikation, die von Gevaert éditions verlegt wird, ist zweiter Teil der Ausstellung. Olivier Foulon wählt aus einem Onlinearchiv drei Texte der Kunstzeitschrift Artforum International aus dem Jahr 2005 über den Künstler Michael Krebber aus und veröffentlicht sie neu. Die Texte wurden bereits auf dem Weg von Druck- zu Online-Format von den ursprünglich begleitenden Illustrationen und Abbildungen, dem „Bild-Make-up“, bereinigt und mit dem lakonischen Hinweis „illustration omitted“ versehen.In beiden Arbeiten hinterfragt Foulon die Bedeutung und Funktionsweise der persönlichen Handschrift eines Künstlers. Indem Gustave Courbet seine eigenen Bilder kopiert, stellt er die Idee der Künstlerhandschrift genauso in Frage, wie Michael Krebber in seiner Arbeit. In Form jährlich wechselnder Ausstellungen gibt die Reihe Der springende Punkt Einblick in Archive von Institutionen oder Personen, die wichtige Anknüpfungspunkte für die kuratorische Arbeit bieten. Ausgangspunkt für die Recherche Foulons war das Marcel Proust-Archiv von Prof. Dr. Reiner Speck. Olivier Foulon ist ein Künstler, der in seinem Werk Anordnungen schafft, in denen Kunst-geschichte neu verhandelt und gelesen werden kann. Seine konzeptuelle Arbeitsweise basiert auf der Aneignung und dem Spiel mit spezifischen historischen Vorlagen. Er beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Original, Kopie und Reproduktion und mit der Lesart und Präsentation von Kunstwerken sowie der Rolle des Künstlers darin.
Unser Dank gilt dem Metropolitan Museum, New York, Nelson-Atkins Museum, Kansas City, Nationalmuseum, Stockholm, Sotheby’s Köln/New York und der Vertretung der Französischen Gemeinschaft Belgiens und der Wallonischen Region
Koproduktion des Kölnischen Kunstvereins und If I can’tdance, Amsterdam.
-
Ausstellung: Many Challenges Lie Ahead in the Near Future, 23.8. – 28.9.2008


Many Challenges Lie Ahead in the Near Future, Miloš Tomic Clay Pigeon, 2005, Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel Mit Milos Tomic, Bojan Sarcevic, Vladimir Nikolic, Lulzim Zeqiri. Kuratiert von Radmila Joksimovic.
Der Ausgangspunkt für die Ausstellung Many Challenges Lie Ahead in the Near Future ist eine unterschwellige Erwartungshaltung, die Künstlern und der Kunst vom Balkan entgegengebracht wird. Wenn es um Künstler geht, die aus der Balkanregion kommen, scheint die Herkunftsfrage sehr oft wichtiger zu sein, als andere Aspekte und Fragestellungen ihrer Kunstwerke. Im letzten Jahrzehnt präsentierten mehrere prominente Ausstellungen, wie In den Schluchten des Balkan, Kunsthalle Fredericianum, Kassel, 2003, Blut und Honig, Sammlung Essl, Wien, 2003, In Search of Balkania, Graz, 2002, usw. dem westlichen Publikum zeitgenössische Künstler, die aus dieser Region stammen. Auch wenn diese Ausstellungen den Künstlern die Gelegenheit gaben, ihre Arbeiten einem internationalen Publikum vorzustellen, haben sie ihnen auch eine Last auf die Schultern gelegt, die in der Frage besteht, was es zu bedeuten hat, ein „Künstler vom Balkan“ zu sein.
Natürlich ist das Wissen des Betrachters über die Herkunft eines Künstlers nicht folgenlos. Es erzeugt bestimmte Erwartungen an die künstlerische Produktion, nämlich sowohl in Form von Bildern als auch von thematischen Fragestellungen, die sich mit dem Kommunismus, den Kriegen auf dem Balkan in den 90er Jahren auseinandersetzen, oder eine bestimmte Art der exotischen Folklore und Tradition aufgreifen, die es nur noch „in den Schluchten des Balkan“ gibt. In so einer Situation stellt sich die Frage, wie sich Künstler dieser Erwartungshaltung stellen. Die hier präsentierten vier Künstler verwenden die erwünschten Bilder als Kern ihrer Arbeiten und problematisieren davon ausgehend ihre künstlerische Position.

Many Challenges Lie Ahead in the Near Future, Lulzim Zequiri Heroes, 2003 Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Many Challenges Lie Ahead in the Near Future, Miloš Tomic Clay Pigeon, 2005, Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Many Challenges Lie Ahead in the Near Future, Vladimir Nikolic, Death Anniversary, 2004, Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Michael Krebber – Pubertät in der Lehre, 21.6. – 28.9.2008


Michael Krebber, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung Pubertät in der Lehre/Puberty in Teaching im Kölnischen Kunstverein 2008 Gast: Stefan Hoderlein
Der Ausstellungstitel Pubertät in der Lehre⁄Puberty in Teaching klingt zunächst paradox, scheinen sich die Begriffe Lehre und Pubertät doch konträr gegenüberzustehen. Es kommen einem sowohl Michael Krebbers Idee von der Pubertät in der Malerei als auch seine Professur an der Städelschule in Frankfurt in den Sinn. Impliziert wird auch die Frage, ob Kunst überhaupt unterrichtet werden kann und, wenn es keinen Lehrstoff gäbe, wie Autorität dann definiert wird. Krebber stellt hier ein von ihm sehr ernsthaft, geradezu leidenschaftlich verfolgtes Thema vor, in dem er entschieden für eine in sich widersprüchliche, quasi pubertäre Haltung eintritt.
Michael Krebber (geb. 1954) ist einer der einflussreichsten in Köln lebenden Künstler und wir freuen uns, seine längst überfällige erste institutionelle Einzelausstellung in Köln zu eröffnen. Krebber spielt gerade für eine jüngere Generation internationaler Künstler wie Merlin Carpenter, Sergej Jensen, Michael Beutler und John Kelsey eine wichtige Rolle. In den 80er und 90er Jahren wurde er bekannt, als Antipode zu den bekannten, in Berlin und Köln wirkenden Positionen, die Maler wie Baselitz, Lüpertz und Kippenberger und Oehlen vertreten haben.
Michael Krebber wurde stets als konzeptuell orientierter Maler gehandelt. Diese Bezeichnung bezieht sich auf ein Werk, das sich seit mehr als fünfundzwanzig Jahren mit den Grenzen und Möglichkeiten der Malerei auseinandersetzt, ohne selbst immer in Form von Malerei aufzutreten. Dabei lenkt diese konzeptuelle Zuordnung von den rein formalen Qualitäten seiner Arbeiten ab. Es stellt sich die Frage, ob Krebber diese Form der Zuweisungen an bestimmten Stellen einfach als Finte für seine Arbeit einsetzt, sind ihr doch simultanes Zu- oder Begreifen und Entziehen, doppelte Böden, Sackgassen und Illusionen immanent.
Aber auch die neuere Bezeichnung Formalismus, einmal vom Nächstbesten als gut funktionierendes Doppelagententum verstanden, soll bei einer Erweiterung des Rezeptions- und Produktionsansatzes zur Debatte stehen.
In der Ausstellung werden ausschließlich Skulpturen gezeigt, puberty in sculpture, Stücke von zersägten Surfboards als Wandskulpturen und eine Außenskulptur auf dem Rasenstück vor dem Kunstverein, die, dem Hollywoodzeichen nachempfunden, den Schriftzug Herr Krebber zeigt. Alle diese Ideen, die entweder schlechte Witze sind oder einfach uninteressant, sind gestohlen oder von irgendwoher kopiert. Surfboards, wie Thunfisch in Scheiben geschnitten und wie eine Donald Judd-Skulptur gehängt, und ein Herr Krebber-Schriftzug installiert, um Grundstückskäufer anzulocken.
Michael Krebber, Pubertät in der Lehre/Puberty in Teaching, Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Michael Krebber, Pubertät in der Lehre/Puberty in Teaching, Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel 
Michael Krebber, Pubertät in der Lehre/Puberty in Teaching, Kölnischer Kunstverein 2008, Installationsansicht, Foto: Simon Vogel
-
Einzelausstellung: Mark Leckey – Resident, 14.4. – 8.6.2008

CENTRAL Kunstpreis
Der CENTRAL Kunstpreisträger Mark Leckey (geb. 1964) präsentiert im Kölnischen Kunstverein die umfassende Einzelausstellung Resident. Der Titel bezieht sich nicht nur auf Leckey’s Residency im Kölnischen Kunstverein, sondern auch auf die Konzeption der Ausstellung entlang der horizontalen und vertikalen architektonischen Hauptachsen des Gebäudes. Leckey greift damit die für ihn kennzeichnende Arbeitsweise auf, seinen Wohnort als Ausgangspunkt seiner Arbeiten zu wählen.
Im Ausstellungsraum, auf horizontaler Achse, präsentiert Leckey die Video-Installation Cinema-in-the-Round (2007), in der der Künstler in einer Art Performance-Vortrag seine Sammlung aus Film-, Fernsehen- und Videozitaten vorstellt. Fasziniert davon, wie die Bilder auf der Leinwand scheinbar zum Leben erwachen, spricht er über die Übergänge vom Zwei- zum Dreidimensionalen und dem Verhältnis von Objekt und Bild. Die skulpturalen Qualitäten des Films werden neben Cinema-in-the-Round auch in dem 16mm-Film Made in ´Eaven (2004) und den Videos Felix gets Broadcasted (2007) und The Thing in Regent´s Park (2006) evident. In Ersterem hat man den Eindruck, die Kamera fängt die berühmte Playboy Bunny-Figur des amerikanischen Künstlers Jeff Koons von allen Seiten ein. Erst wenn man die Reflexion in der hochglänzenden Skulptur bemerkt, die das Atelier des Künstlers, jedoch nicht die Kamera spiegelt, begreift man, dass es sich um eine animierte Sequenz handelt. Diese ist wiederum ins 16mm-Format übertragen und wird wie eine Skulptur auf einem Sockel präsentiert. Bei The Thing in Regent´s Parks ist eine merkwürdige animierte Skulptur (von J. D. Williams) zu sehen, die durch den Londoner Regent´s Park läuft und damit einen Weg nimmt, den der Künstler täglich benutzt, um zu seinem Studio zu gelangen. Darüber hinaus wird der Künstler eine Abbildung der Hahnskulptur, die vor dem Kunstvereinsgebäude postiert ist, im Ausstellungsraums mittels eines Zoetropezum Laufen bringen – einem Gerät, das die Illusion bewegter Bilder vermittelt. Selbst die Werbung für die Ausstellung hat der Künstler übernommen. Zwei Fenster des Ausstellungsraums verändert Mark Leckey zu Schaufenstern, in denen er seine künstlerischen Produktionen im Inneren vorstellt und bewirbt, und damit – für die Passanten sichtbar – die Folge der kleinen Schaufenster auf der Hahnenstraße imitiert.
Vom Keller bis in den Theatersaal verläuft die Vertikale mit Arbeiten, in denen Leckey die Mechanismen des Fernsehens reflektiert. Im Mittelpunkt steht die Cartoonfigur Felix the Cat, deren Abbildung in den 20er Jahren für die ersten amerikanischen Fernsehübertragungen als Testbild verwendet wurde. Auf der Bühne im Theatersaal baut Leckey eine Art Filmset für die Cartoonfigur Felix auf, die nach einer Fotovorlage der Filmkulisse aus den 20er Jahren mit einzelnen Requisiten nachgestellt wird. Im Kino sieht man schließlich eine humorvollen Felix-Animation im 16mm-Format und im Keller schließlich findet man eine Soundskulptur, die die Form einer Heizmaschine hat und die ganze Installation von unten anzufeuern scheint.
Die internationale Jury des mit 75.000 € dotierten Central Kunstpreises 2008 setzte sich aus den Kuratoren Heike Munder (Migros Museum Zürich), Catherine Wood (Tate Modern London) und Charles Esche (VanAbbe Museum Eindhoven), dem Vorstandsvorsitzenden der CENTRAL Krankenversicherung Dr. Joachim von Rieth sowie Kathrin Jentjens und Anja Nathan-Dorn zusammen.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog in Zusammenarbeit von Kölnischer Kunstverein und Le Consortium, Dijon.
-
Ausstellung: Konzepte der Liebe, 9.2. – 30.3.2008

Mit Gerry Bibby, Bless, Keren Cytter, Ekkehard Ehlers, Stephan Geene, Frauke Gust, Judith Hopf, Francesca Lacatena, Henrik Olesen, Monika Rinck, de Rijke⁄de Rooij, Jörg Rode, Deborah Schamoni, Klaus Theweleit, Florian Zeyfang.
Eingeladen von Judith Hopf, Kathrin Jentjens und Anja Nathan-Dorn.Eröffnung am 08.02.2008 mit einer Performance von Gerry Bibby und Liebesliedern, aufgelegt von Ekkehard Ehlers und Olaf Karnik.
Konzepte der Liebe ist eine Ausstellung, die künstlerischen Diskursen, Produktionen und Positionen nachgeht, welche die Erfahrung des „In-Liebe-Fallens“ als radikalisierende Bewegungsform thematisieren, oder besser: mitdenken.
Die Erfahrung des „In-Liebe-Fallens“ lässt sich bekanntlich nicht herstellen, da sie außerhalb der rationalen Entschlussmöglichkeit liegt. Dabei wird die Liebe selbst nicht als irrational betrachtet. Sie wird mit unzählbaren politischen, begehrens-orientierten und ästhetischen Projektionen, Strukturen und Konzeptionen verbunden. Die Gespräche, Produkte und Analysen von Liebenden über eben diese Liebeskonzeptionen stehen dabei meist in einem Gegensatz zu einer kapitalistischen Verweislogik, da sich diese möglicherweise anheizen, verhindern, manipulieren, psychoanalytisch erklären, aber einfach nicht erfolgsorientiert „rechnen“ lassen. Liebe kann erst dann wirken, wenn der oder die Liebende zur wechselseitigen Annerkennung der Differenz zum anderen gelangt, oder wenn es ihr⁄ihm gelingt, wie es die Autorin Monika Rinck zum Ausdruck bringt, „über das Ich hinaus auch das Du zu denken“.
Folgt man zum Beispiel Roland Barthes’ Thesen und Erfahrungen so sind Hypersensibilität, Überschreitung, Verschwendung, Beschleunigung, Verlangsamung und unvorhersehbare Bewegungen gegen die Funktionalisierung und Ökonomisierung des Subjektes alltägliche Handlungen und Erfahrungen der Liebenden. Die Unfähigkeit sich so in „Liebe (zu) gefallen“, sich an die Bedingungen und Anforderungen der Alltags- und Arbeitswelt anzupassen, wird nicht als Schwäche sondern gerade als (auch politische) Stärke verstanden. Trotz der liebestollen Blindheit sieht man scharf, gelangt zu den zärtlichsten Erkenntnissen und handelt radikal, und – im gesellschaftlichen Konsens gesehen – oft „falsch“.
Ausgangspunkt für Konzepte der Liebe ist die Arbeit von Judith Hopf, mit der wir die Ausstellung gemeinsam entwickeln. In ihrer Arbeit spielt die Frage nach dem Impuls und dem sozialen und gemein- schaftlichen Sinn für eine mögliche Produktivität, die sich in der Polis vermittelt und verhandeln lässt (oder eben nicht), eine wichtige Rolle. Der Begriff Konzepte der Liebe ist ihrem Sprachgebrauch entlehnt und ihrer Betrachtungsweise gesellschaftlicher, sozialer oder künst- lerischer Prozesse. So geht es in der Ausstellung auch keineswegs um eine Genealogie oder eine Analyse unterschiedlicher Liebeskonzepte, sondern vielmehr um bestimmte (auch historische) Konzepte und Begriffe der Liebe, die sowohl für Hopf als auch für die anderen beteiligten Künstler auf je unterschiedliche Art und Weise bedeutsam sind.
Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten, wie die Ko-Produktion von Judith Hopf und Stephan Geene Bei mir zu dir (tv. Low-dunkel), 2005, oder Elevator Curator, 2005, und Hospital Bone Dance, 2006, von Judith Hopf und Deborah Schamoni, sowie weiteren Arbeiten von Gerry Bibby, de Rijke⁄de Rooij, Florian Zeyfang, dem Musiker Ekkehard Ehlers und dem Künstler Jörg Rode, sowie von der Autorin Francesca Lacatena, zeigen unterschiedliche Versuche, eine Sprache für diese Bewegungen der Liebe zu finden. Das Modelabel Bless stellt dazu das Exhibition Furnish. Im Sinne eines Moments von Intensivierung und Verschwendung werden einige Künstler wie Keren Cytter und Henrik Olesen eigene Satelliten oder kleine Kosmen innerhalb der Ausstellung entwickeln. Eine Lesung mit der Autorin Monika Rinck und ein Vortrag von Klaus Theweleit wird Konzepte der Liebe in zwei Veranstaltungen erweitern.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Texten von Judith Hopf, Frauke Gust, Monika Rinck, Kathrin Jentjens und Anja Nathan-Dorn.
Wir danken dem Filmclub 813 für die Zusammenarbeit.
Die Ausstellung wird unterstützt von der Kunststiftung NRW und HDI Gerling.
-
Ausstellung: Élégance, 3.11. – 23.12.2007

Wie verhält sich die Kunst zum Geld? Ist Kunst nichts als ein Konsumobjekt? Sind politische Inhalte mehr als ein preissteigernder Faktor am überhitzten Kunstmarkt? Welche Spielräume bleiben, wenn private Sponsoren die Lücken der öffentlichen Förderungen schließen sollen? Wie können sich Sponsoren anders als in Form von Kapital in die Kunst einbringen? Sind Kreativität, kritisches Selbstverständnis und gesellschaftliches Bewusstsein nicht unerlässliche Kennzeichen moderner Marktstrategien? Und ist die Produktion von Glamour nicht schlicht eine Überlebensstrategie in Zeiten des Neoliberalismus? In vier ambivalenten Installationen geht Élégance diesen Fragen nach.
In Julika Rudelius’ Videoinstallation Economic Primacy (2005) sprechen Topmanager und Millionäre über ihr Verhältnis zum Geld. Dabei ist es ein Merkmal von Rudelius’ Arbeit, an den Stellen genauer nachzufragen, wo man es gewöhnlich mit festen, medial vermittelten Bildern zu tun hat. Jeder der Manager wird dabei in dem anonymen Büro eines Geschäftsgebäudes gezeigt. Sie beantworten vom Betrachter ungehörte Fragen, die ihnen über die Telefonsprechanlage gestellt wurden.
Merlin Carpenter, dessen malerische und installative Arbeit in einem institutionskritischen Umfeld verwurzelt ist, präsentiert unter dem Titel David’s Soul (1999/2007) vier prestigeträchtige Mercedes-Benz-Mountain-Bikes als Ready-made. Die Räder sind von Mercedes-Benz oder der Daimler AG nicht kostenlos zur Verfügung gestellt worden, sondern wurden regulär erworben. In bewusster Parallele zum Kunstmarkt nutzt Carpenter Produkte eines globalen Marktes, die ihren Wert nicht zuletzt über ihren Namen entwickeln.
Für sein Projekt Radical Loyality (seit 2003 fortlaufend) hat Chris Evans ein Gelände in Estland angekauft, auf dem er ein Skulpturenpark verwirklichen will. Im Sinne eines ideellen Sponsorings hat er die Direktoren großer internationaler Firmen nicht um finanzielle Projektförderung gebeten, sondern im Gespräch über das Thema Loyalität gemeinsam mit ihnen Ideen für Skulpturen entwickelt. Estnische Bildhauer, die in Zeiten des Kommunismus Sowjetdenkmäler schufen, sollen diese Entwürfe nun für den Skulpturenpark umsetzen. Im Kölnischen Kunstverein wird der bisherige Projektverlauf dokumentiert.
-
Einzelausstellung: Boris Sieverts – Büro für Städtereisen, 23.8. – 30.9.2007


Boris Sieverts, Ankündigungsmotiv zur Ausstellung Büro für Städtereisen im Kölnischen Kunstverein 2007 Seit genau 10 Jahren führt Boris Sieverts durch Stadtlandschaften. Angefangen hat er damit in Köln, auf der rechten Rheinseite, vor seiner Haustür. Es folgten weitere Führungen in Köln, dann eine ganze Reihe im Ruhrgebiet, in Paris, Rotterdam und andernorts. Und immer wieder in Köln.
Seit 2000 bietet er diese Reisen über sein Büro für Städtereisen an. Die ein- und mehrtägigen Pauschalreisen des Büros für Städtereisen führen durch jene Zonen unserer Stadtlandschaften, die – abseits der Touristenziele der Innenstädte und der bekannten Ausflugsgebiete – bis dahin als Reiseziele nicht in Betracht kamen. Dabei sind es gerade diese inneren und äußeren Ränder der Metropolen und die Zwischenräume der Ballungsgebiete, die einen binnen kurzer Zeit aus dem eigenen Kulturkreis entführen können und den Blick für die Weite und Vielfalt des Raumes öffnen, die dort möglich sind, wo nichts dargestellt werden muss. Sieverts´ Wanderungen und Radtouren verknüpfen Brachflächen und Siedlungen aller Art, Parkplätze, Abrissszenarien, Baggerseen, Wälder, Wiesen, Gärten, Autobahnen, Schulen, Häfen, Asylantenheime, Gleistrassen, Manöverplätze, Gewerbegebiete, Flughäfen, Tunnel, Tiefgaragen, Sackgassen, Trampelpfade, Flussauen, Deponien und vieles mehr zu wunderschönen bis krassen Raumfolgen.
Für die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein hat Boris Sieverts ein Programm aus acht Führungen zusammengestellt, davon sieben in Köln und Umgebung. Einige Touren stammen aus den Anfangsjahren, andere finden zum ersten Mal statt. Alles in allem eine einmalige Gelegenheit für Interessierte, sich in einem konzentrierten Zeitrahmen intensiv diesem in kein Schema passenden Stadtraum und seiner Agglomeration auszusetzen. Mit der Ausstellung Boris Sieverts’ Büro für Städtereisen wollen wir dezidiert auf eine künstlerische Praxis hinweisen, die sich außerhalb des Kunstmarkts und des Formats Ausstellung bewegt. Seine Arbeit ist eine funktionierende Form von Kunst als Dienstleistung. In diesem Sinne wird Boris Sieverts’ Reisebüro in den Kunstverein umsiedeln und der Kunstverein zum Ort der Vermittlung.
-
Ausstellung: Pure Self Expression, 2.6. – 12.8.2007

Dirk Bell, Lisa Lapinski, Manuela Leinhoß, Melvin Moti, Mai-Thu Perret
Die KünstlerInnen Dirk Bell, Lisa Lapinski, Manuela Leinhoß, Melvin Moti und Mai-Thu Perret gehen auf sehr unterschiedliche Weise ihrem Interesse an kulturellen Phänomenen nach, die sich dem Unbewussten verschrieben haben. Bisweilen geraten sie dabei in einen schillernden Konflikt mit ihrer eigenen kritischen Position und einem rationalistischen Weltbild. In der Ausstellung Pure Self Expression sind Installationen, Skulpturen und Malerei zu sehen, die eine Nähe zu Handwerk und Selbstgemachtem verraten. Auf dieser formalen Ebene stellen sie die Frage von Autorschaft, die durch die referentielle Aufladung der Objekte wieder in Frage gestellt wird.
Lisa Lapinskis Skulptur Nightstand besteht aus aufeinander getürmten Möbeln, Schubladen, Schranktüren, Fundobjekten und Fotos. In der pyramidalen Anordnung lehnt sich Lapinski formal an die Zeichnungen von Lebensbäumen der religiösen Shakergemeinschaften des 19. Jahrhunderts an. Auch die verwendeten Gegenstände sind Möbeln der Shaker nachempfunden, die als Vorläufer des modernen Designs gelten.
Seit 1999 schreibt Mai-Thu Perret an The Crystal Frontier, einem fiktiven Text über eine Gruppe von Frauen, die die Großstadt verlassen, um eine autonome Kommune in der Wüste zu gründen. Dabei entstehen Banner, Requisiten, Teppiche oder Keramiken, funktionale wie funktionslose Gegenstände, die als Objekte dieser anonymen Gruppe ausgestellt werden und etwas von der Psyche dieser fiktionalen Gruppe aussagen sollen. Die Künstlerin spielt hier mit den Fragen von Autorschaft und beschreibt sich sozusagen als Produzentin eines “Guppenmaterials”.
Die Titel von Manuela Leinhoß’ Skulpturen wie Ich lerne aus der Vergangenheit, Fin de Siècle, Symmetrie, Anatomie und Schicksal! oder reziprok sind Teil des Spiels mit dem Missverhältnis von Objekt, Titel und Bedeutung. Ihre fragilen Objekte aus Gips, Kunstleder, Holz oder Papier scheinen miteinander in Kommunikation zu treten. Mit Präzision verzichtet sie auf Perfektion, erzeugt den Eindruck des Selbstgemachten und Unstabilen, und setzt sich damit bewusst selbst ins Werk.
Dirk Bells Malerei, Zeichnungen und Collagen verweisen in ihrer ephemeren formalen Erscheinung auf Vorbilder wie die Symbolisten, William Blake oder Leonardo da Vincis Zeichnungen. Sie scheinen in fast überzogenem Maße an die alte Vorstellung von der Kunst als einer Traumwelt zu appellieren. Bell zielt dabei sehr bewusst auf formale und inhaltliche Bezüge, die zunächst als Faux-pas erscheinen. Gerne ergänzt Bell seine Ausstellungen durch Objekte wie auf dem Flohmarkt gefundene Malerei oder T-Shirts, die den Referenzen ihre inhaltliche Überhöhung nicht zugestehen, sondern sie in ein gewöhnliches Feld popkultureller Verweise eingliedern. In dem er in gefundene Bilder hineinmalt, stellt er auch die Frage nach dem subjektiven Filter, den jede Rezeption darstellt.
Der Film The Black Room von Melvin Moti kombiniert ein fiktives Interview mit Robert Desnos über seine Experimente des automatischen Schreibens unter Selbst-Hypnose im Kreise der Pariser Surrealisten 1923 mit einer sehr langsamen Kamerafahrt entlang der Wände der römischen Villa Agrippa in der Nähe von Pompeiji. Hier wurden als Wanddekoration der Wände erstmalig Grotesken eingesetzt. Sie stehen für den Übergang von realistischer Illusion hin zu einer neuen Imaginationskraft und freien Repräsentation der Welt. Die Fresken spannen sozusagen den Bogen von trompe l´oeil zu Magie. Die Frage, wie spirituelle Erfahrung rekonstruiert und vermittelt wird, ist wichtiger Ausgangspunkt für Melvin Motis künstlerische Arbeit.
Die Ausstellung wird unterstützt durch:
Sparkasse KölnBonn, die Botschaft des Königreichs der Niederlande, Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung und U.S. Consulate General, Düsseldorf/Amerika Haus
Lisa Lapinski, Nightstand, 2005. Kölnischer Kunstverein 2007, Installationsansicht, Foto: Thorsten Schneider 
Pure Self Expression, Kölnischer Kunstverein 2007, Ausstellungsansicht, Foto: Thorsten Schneider 
Pure Self Expression, Kölnischer Kunstverein 2007, Ausstellungsansicht, Foto: Thorsten Schneider 
Pure Self Expression, Kölnischer Kunstverein 2007, Ausstellungsansicht, Foto: Thorsten Schneider 
Pure Self Expression, Kölnischer Kunstverein 2007, Ausstellungsansicht, Foto: Thorsten Schneider
-
Ausstellung: Der springende Punkt: Happening und Fluxus, Kölnischer Kunstverein 1970, ausgewählt und präsentiert von Marcel Odenbach, 20.4. – 21.12.2007

Archivreihe
2. Obergeschoss
In Form einer jährlich wechselnden Ausstellung gibt Der springende Punkt Einblick in Archive von Institutionen oder Personen, die auf Grund ihrer experimentellen Ausstellungsprogramme oder besonderen kuratorischen Handschrift wichtige Anknüpfungspunkte für die Arbeit des Kölnischen Kunstvereins bieten.
Für die Entwicklung dieser Reihe ist jeweils eine Zusammenarbeit mit einem Künstler vorgesehen, der eine besondere Affinität zu der jeweils ausgewählten Institution hat. Der Künstler wird eingeladen, das Archivmaterial zu recherchieren und eine entsprechende Präsentation dafür zu entwickeln. Somit geht es um die Auswahl eines bestimmten Moments der Geschichte dieser Institution, der durchaus persönliche Bedeutung für Künstler wie Kuratorinnen hat, nicht um die Präsentation eines Gesamtarchivs.Für diese Ausstellung ist der Kölner Künstler Marcel Odenbach eingeladen. Seine lange Aktivität im Kunstverein als Künstler und Mitglied, gepaart mit seinem Interesse an der Auf- und Verarbeitung von Geschichte(n) ist eine ideale Voraussetzung für die Beschäftigung mit diesem Archiv. Ausgangspunkt seiner Recherche ist die Ausstellung Happening und Fluxus von 1970, durch die er zum ersten Mal auf den Kölnischen Kunstverein aufmerksam wurde. Nicht nur sein Großvater, sondern eine große Gruppe an Mitgliedern aus dem Kölner Süden verließ anlässlich der aktionistischen, provozierenden Ausstellung empört den Kunstverein. Gleichzeitig traten aber auch eine große Gruppe an jungen, neuen Mitgliedern in den Kunstverein ein.
Happening und Fluxus war schon in der Auswahl der Künstler und in der Art der Installation mit Konfliktbereitschaft angelegt. Interessant an dieser Ausstellung und den durch sie ausgelösten Ereignissen ist die Frage nach der gesellschaftlichen Rolle der Kunst in der frühen Zeit der Bonner Republik, die sich in der öffentlichen Diskussion der Ausstellung durch Politiker und Bürger widerspiegelt, aber auch die Frage nach der Kunststadt Köln. Odenbach zeigt Ausstellungskataloge, Editionen, Briefe, Fotos und weitere Dokumente als eine Auswahl von Materialien, die den historischen Moment aus dem Blickwinkel der Ausstellungsmacher Harald Szeemann und Wolf Vostell, des Kunstvereinsdirektors Toni Feldenkirchen und der Perspektive des Publikums einfangen soll.

Ausstellungsansichten Happening und Fluxus“ in der Archivreihe „Der springende Punkt, präsentiert von Marcel Odenbach, 2007, Fotos: Michael Strassburger 
Ausstellungsansichten Happening und Fluxus“ in der Archivreihe „Der springende Punkt, präsentiert von Marcel Odenbach, 2007, Fotos: Michael Strassburger 
Detailansicht, Ausstellungsvitrine aus „Happening und Fluxus“, 2007 (mit Editionen von George Brecht, John Check, Albert M.Fine, Ken Friedman, Geoffrey Hendricks, Alice Hutchins, Jane Knick, Milan Knick, Oliver Mosset, Benjamin Patterson, Jock Reynolds, Paul Sharifs, Ben Gautier, Yoshidas Wada, Robert Watts), Leihgabe: Walther König, Köln, Foto: Simon Vogel
-
Ausstellung: Mark Bain und James Beckett – Museum of Noise, 3.3. – 20.5.2007

Mit der Ausstellung Museum of Noise: Mark Bain und James Beckett präsentiert der Kölnischer Kunstverein zwei Künstler, die sich an der Schnittstelle von Konzeptkunst, Soundart und experimenteller Musik bewegen. Für Museum of Noise haben beide Arbeiten entwickelt, die den Ausstellungsraum des Kölnischen Kunstvereins, der sich durch seine doppelten Fensterreihen auszeichnet, wie eine Vitrine in der Stadt nutzen. Für seine Arbeit Transparent Structures (2007) verwandelt Mark Bain (geb. 1966) den Saal in einen Lautsprecher. Er installiert Mikrophone an der Außenfassade des Gebäudes, die die Geräusche der Umgebung aufnehmen. Diese werden über Vibrationsumwandler, die Bain an die großen Fensterscheiben des Ausstellungsaal montiert, abgespielt, so dass die Fenster zur Membran und der Ausstellungsraum selbst zum Resonanzraum eines überdimensionierten Lautsprechers werden. Bain löst mit seiner Arbeit die akustische Grenze zwischen Innen und Außen auf und zielt damit auf eine Reflexion der unterschiedlichen Arten öffentlichen Raums und den damit verbundenen Zugänglichkeiten, mit denen der Ausstellungsbesucher, der Fußgänger und die Mitarbeiter des angrenzenden Amerikahauses konfrontiert sind.
James Beckett (geb. 1977) hat in seiner Arbeit Spade-Scrapes 1-6 (2007) Kopien von Architekturmodellen Riphahns angefertigt, die er im Ausstellungsraum wie Schatten neben den Originalmodellen präsentiert. Der Ausstellungsraum selbst dient ihm dabei als Vitrine. Gleichzeitig spielt er mit der Idee, dass in einer Vitrine Realität in Form von Ausstellungsexponaten, gedoppelt und zu einem Gegenstand verkleinert wird, so dass Einordnung und Reflexion möglich werden. Vor den doppelten Modellen steht jeweils ein Spaten. Diese Spaten hatte Beckett in einer nicht-öffentlichen Aktion verwendet, um vor den realen Gebäuden Riphahns eine Linie auf die Straße zu ziehen und durch die schleifende Bewegung des Spatens auf dem Asphalt einen kratzenden Ton zu erzeugen. Im Ausstellungsraum sind diese Spaten verstummt und nur noch Reminiszenz des in der Performance erzeugten Tons. Mit seiner Aktion verweist Beckett auf Riphahn, der in seiner regen Bautätigkeit ständig neue Materialkombinationen ausprobierte.
James Becketts Interesse an Sound hat sich aus seiner installativen Arbeit entwickelt. Das Projekt A Partial Museum of Noise (2003/2007) das auch im Kölnischen Kunstverein zu sehen sein wird, nimmt darin einen besonderen Platz ein. Es dokumentiert die kulturellen und physiologischen Auswirkungen unterschiedlichster Formen von Lärm und kommentiert gleichzeitig museale Präsentationsformen. Auch in anderen Arbeiten, wie den Monkhouse Traffic Profiles (2006) verwandelt Beckett wissenschaftliche Standards und Mess- und Ordnungseinheiten in ästhetische und hinterfragt damit Ihre Unanfechtbarkeit.Mark Bain, der für Arbeiten bekannt ist, mit denen er die Eigenschwingung von Materie inszeniert, hat an verschiedenen Stellen des Gebäudes Kopfhörer (Buzz Phones, 2007) montiert, über die man die Geräusche, die die Elektronik und der Stromfluss des Gebäudes erzeugt, abhören kann. Mittels der körperlichen und akustischen Erfahrung von Architektur erzeugt Bain einen unheimlichen Effekt. Er untersucht darin, ob wir noch Herr über die uns umgebenden architektonischen Strukturen sind oder diese über uns. Auch in Bains Neufassung der Videoarbeit Feed carnivore-Nine times Playtime (2007) scheint die Technik sich zu verselbständigen. Neun DVD-Ausstrahlungen von Jacques Tatis’ Playtime überlagern sich in dieser Videoprojektion. Die neun Videos verlieren allmählich Ihre Synchronität und die architektonischen Modelllandschaften Tatis zersplittern und vermischen sich zusehends.
-
Ausstellung: Cameron Jamie, Peter Kogler, Kurt Kren – Keine Donau, 4.11. – 17.12.2006

Die Ausstellung Keine Donau führt drei künstlerische Positionen zusammen und stellt sie zueinander in Beziehung. Cameron Jamie und Peter Kogler haben für den Kölnischen Kunstverein Filme des 1998 verstorbenen Undergroundfilmers Kurt Kren in die gemeinsam entwickelte Ausstellung eingebunden, in deren formalem Mittelpunkt die Wechselbeziehung zwischen Kunst, Film und Architektur steht. Experimentelle Filme von Kurt Kren, der zu den wichtigsten Vertretern der internationalen Filmavantgarde zählt und als einer der Wegbereiter des strukturellen Films gilt, stehen dabei im Dialog mit neuesten raumbezogenen Arbeiten von Peter Kogler und mit Arbeiten des amerikanischen Künstlers Cameron Jamie.
Der Ausstellungstitel ist einem Film von Kurt Kren entliehen. Die radikale Auseinandersetzung mit dem Medium Film und die genaue Analyse von Wahrnehmung sind charakteristisch für das filmische Werk Kurt Krens. Kurt Kren hat aus den grundlegenden Faktoren des reinen Kinos – Bewegung, Material, Licht und Wahrnehmung – seine Filme entwickelt und dabei nicht nur mit Licht und Wahrnehmung, sondern auch mit den Apparaturen des Filmemachens experimentiert. Extrem schnelle Schnitte, die auf Partituren mit seriellem, strukturellem und mathematischem Charakter beruhen, Mehrfachbelichtungen, Unschärfen, Behandlungen der Tonspur durch Kratzung und Zeichnung bestimmen die vibrierende und dynamische Bildsprache Kurt Krens, die eine neue Form des Bildes und der Wahrnehmung entstehen lässt.
Die von Peter Kogler für den großen Ausstellungsraum des Kunstvereins konzipierte Videoinstallation stellt Verbindungen zwischen einem der zentralsten strukturellen Filme Kurt Krens, „48 Köpfe aus dem Szondi-Test“, und einer eigenen, neuen Arbeit sowie mit Cameron Jamies Studien für den Film „Spook House“ her. Peter Kogler hat bereits früh, zu Beginn der 80er Jahre mit den damals aufkommenden Computertechnologien experimentiert und nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht. Ausgehend von den konzeptuellen Erfahrungen der Pop-Art im Umgang mit Massenmedien, mit der Idee des Seriellen und mit den neuen Reproduktions-Technologien entwickelte er seit Anfang der 90er Jahre „virtuelle“ Bildwelten, die Körper und Räume überspielen und in denen die Grenzen von Bild, Skulptur, Architektur und Medien aufgehoben scheinen. Seine Transformierungen von raumgreifenden Zeichen und Bildern verweisen auf eine vollkommene Durchdringung des öffentlichen und privaten Raumes mit diesen Zeichen und auf eine damit einhergehende Verschmelzung dieser Bereiche.
Die Arbeiten Cameron Jamies sind vom Phänomen Fantasy und von Beobachtungen und Erfahrungen subkultureller Repräsentationsformen in urbanen, amerikanischen Vorstädten wie auch in europäischen Alltagskulturen geprägt. Amerikanische Backyard Wrestler, ‚spook houses’ und andere unheimlich anmutende theatralische Inszenierungen, die mit Tod, Verdrängung, Angst und Gewalt zu tun haben, sind nur einige Rituale einer Alltagskultur, die Cameron Jamie mit seiner Kunst erforscht. Sein Blick gilt den Auswirkungen dieser rituellen Praktiken auf die Psyche und das Alltagsleben, ebenso wie der ihnen immanenten Phantasie und Poesie.
Die Ausstellung Keine Donau zeigt neben filmischen Arbeiten auch Zeichnungen, Skizzen, Kaderpläne, Objekte, sowie eine Skulptur, die Cameron Jamie gemeinsam mit dem österreichischen Schnitzer Max Kössler für die Ausstellung produziert hat. In die Ausstellung miteinbezogen ist auch eine Auswahl von aktionistischen Filmen Kurt Krens, die in Zusammenarbeit mit seinen Künstlerkollegen Otto Mühl und Günter Brus entstanden sind. Im Zusammenspiel der verschiedenen künstlerischen Positionen ist eine Ausstellung entstanden, die von Überschreitungen und Ausdehnungen von Grenzen handelt. Die Ausstellung reflektiert ein Unheimliches und ein Abgründiges unserer Gesellschaft, dessen Repräsentationen im Alltäglichen irritierende und angstbesetzte Dimensionen entwickeln können. Auch die Nachtversion der Ausstellung setzt die Grenzen des Innen- und Aussenraums scheinbar ausser Kraft, wenn die Fensterfront des großen Ausstellungsraumes sich zur Straße hin „öffnet“ und die Arbeiten von Cameron Jamie, Peter Kogler und Kurt Kren in die Stadt hinausstrahlen: Referenz auch an die große Kinotradition des Kunstvereinsgebäudes.
Cameron Jamie, geboren 1969 in Los Angeles, lebt und arbeitet in Paris.
Ausstellungen (Auswahl): Whitney Biennale, New York (2006); MUKA, Antwerp (2005); Walker Art Center, Minneapolis (2006); Venice Biennale (2005); Bernier/Eliades Gallery, Athens (2005); Magasin/Musée Gó-Charles, Grenoble (2004); Artangel London (2003); The Wrong Gallery, New York (2003); Galerie Christine König, Vienna (2003); Centre Georges Pompidou, Paris (2002); Rotterdam International Film Festival (2001); Stedelijk Museum, Ghent (2001).Peter Kogler, geboren 1959 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien.
Ausstellungen (Auswahl): Museum of Modern Art, New York (2006); Casino Luxemburg, Luxembourg (2005); Galerie Mezzanin, Vienna (2005); Museum für angewandte Kunst, Vienna (2004); Galerie im Taxispalais, Innsbruck (2004); Kunstverein Hannover (2004); Galerie Crone, Berlin (2004); Bawag Foundation, Vienna (2003); Venice Biennale (2003); Schauspielhaus Frankfurt (2002); Villa Arson, Nice (2002); Fondation Beyeler, Basel (2001); Kunsthaus Bregenz (2000); Ars Electronica, Linz (1999); documenta X, Kassel (1997); documenta IX, (1992).Kurt Kren (1929-1998) war ein avantgardistischer Filmemacher, der in Houston/Texas und Wien gelebt hatte.
Seit der Mitte der 1960er Jahre nahm er an internationalen Filmfestivals teil und war international als einer der wichtigsten Underground-Filmemacher bekannt. Ausstellungen (Auswahl): documenta, Kassel (1977); Kölnischer Kunstverein (1977); Hayward Gallery, London (1979); Retrospective, Museum of Modern Art, New York (1979); Secession, Wien(1996); Atelier Augarten, Wien (2006). -
Einzelausstellung: Sanja Ivekovic – General Art. Selected Works 1974-2006, 1.9. – 15.10.2006

Sanja Ivekovic zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen einer ‚mittleren’ Generation. Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein zeigt neben einer umfassenden retrospektiven Auswahl ihres Werks auch neueste Arbeiten. Die seit Mitte der siebziger Jahre entstandenen Fotografien, Videoarbeiten, Objekte und Performances von Sanja Ivekovic scheinen auf den ersten Blick den Gesetzen einer glamourösen Popkultur zu folgen. In „Double Life” aus dem Jahr 1975 etwa hat Sanja Ivekovic den gängigen ikoneartigen Magazin- und Werbefotos von Frauen private Aufnahmen von sich selbst entgegen gestellt, deren verwandter Gestus zu einer vergleichenden und reflexiven Lesart drängt. Ihre eigene Person und damit das Private in den öffentlichen Diskurs einschreibend, geht Sanja Ivekovic in ihren Arbeiten der Frage nach, wie die Routinen des Alltags vom Diktat der Mode, der Werbung und des Starkults beeinflusst werden. Der Körper ist dabei für die Künstlerin immer nur der Körper in der Darstellung – eine Bildfläche, die vom Blick dominiert wird. Sanja Ivekovic setzt sich bewusst dem männlichen Blick aus und stellt Körper, Sexualität und Geschlecht nachdrücklich in den Kontext des Politischen. In ihren jüngsten Arbeiten nimmt sie dabei auch Bezug auf den Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens, die ethnischen Säuberungen, die Lebensbedingungen von Flüchtlingen und den antifaschistischen Widerstand von Frauen.
Die Ausstellung wurde in Kooperation mit der Galerie im Taxispalais, Innsbruck realisiert, die 2001 die erste umfassende Einzelausstellung von Sanja Ivekovic gezeigt hat.Sanja Ivekovic, geboren 1949 in Zagreb, lebt und arbeitet in Zagreb. Ausstellungen (Auswahl): „Open Systems: Rethinking Art c. 1970”, Tate Modern, London (2005); „Die Regierung”, Secession (2005); „Women´s Room”, Palazzo Ferreri, Genova (2004); documenta 11, Kassel (2002); „Personal Cuts”, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (2001); „After the Wall”, Budapest, Stockholm, Berlin (2000/2001); „Translocation”, Generali Foundation, Wien (1999); Manifesta 2, Luxemburg (1998); „Body and the East”, Moderna Galerija, Ljubljana (1998), Museum für zeitgenössische Kunst, Zagreb (1997).
Die Ausstellung wird von Nataša Iliæ und Kathrin Rhomberg kuratiert.
Diskussion
Mit der Künstlerin diskutieren Marie-Luise Angerer, Medientheoretikerin, Köln; Sylvia Eiblmayr, Kunsthistorikerin, Direktorin der Galerie im Taxispalais, Innsbruck; Nataša Iliæ, Kunsthistorikerin, Kuratorin der Ausstellung, Zagreb; Bojana Pejiæ, Kunsthistorikerin und Kuratorin, Berlin; Charles Esche, Direktor des Van Abbemuseum, Eindhoven (angefragt).
Mi, 04. Oktober, 19 UhrFilmabend
Anlässlich ihrer Ausstellung präsentiert Sanja Ivekoviæ im Kino in der „Brücke” eine Auswahl ihrer Videoarbeiten von 1974 bis 2003.
Sa, 07. Oktober, 19 UhrDank an: Sylvia Eiblmayr, Galerie im Taxispalais Innsbruck. Sylvia Eiblmayr zeigte 2001 die erste umfassende Einzelausstellung von Sanja Ivekovic. Ein großer Teil der Arbeiten dieser Ausstellung wird auch im Kunstverein gezeigt.
Die Leihgeber: Sammlung Generali Foundation, Wien; Sammlung Block, Berlin; Kontakt. Die Kunstsammlung der Erste Bank-Gruppe, Wien; Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Wien; Museum of Contemporary Art, Zagreb.
Die Sponsoren: Privatbrauerei Gaffel, Becker & Co., Kunsttrans, Zagreb; Mireille Ruch („Der Blumenladen”, Köln); MACtac Germany; VPS, Krefeld; Stadt Köln.
-
Einzelausstellung: Jutta Koether – Fantasia Colonia, 26.5. – 13.8.2006

Jutta Koether ist eine der zentralen Figuren für die gegenwärtige Malerei. Sie ist aber doch mehr als eine Malerin. Sie ist auch Performancekünstlerin, Musikerin, Schriftstellerin, Kritikerin und Theoretikerin.
Ihre Rolle als Künstlerin wurde lange Zeit als feministische Antwort auf die Kölner Szene der späten achtziger Jahre reduziert. Mit ihren durchscheinenden Farbfeldern, dem gestischen Pinselstrich, Zeichnungen weiblicher Körper sowie der lyrischen Aneignung von Poesie und Kunstgeschichte scheint sie häufig die gegenüberliegende Position von Künstlern wie Martin Kippenberger, Sigmar Polke und Albert Oehlen einzunehmen. Als Kritikerin und Redakteurin der Musik- und Popkulturzeitschrift Spex sowie als Performancekünstlerin und Musikerin entsprach Koether aber nicht dem typischen Berufsbild der Kunstszene jener Zeit.Seit Beginn ihrer künstlerischen Karriere hat Jutta Koether versucht, Erweiterung zu ihrem Programm zu machen. Dabei war es ihr immer auch wichtig, keine eindeutige Rolle als Künstlerin einzunehmen, sondern immer aus mehreren Positionen zu arbeiten. Seit sie in den 90er Jahren nach New York kam, bewegt sie sich in erweiterten Feld von Experiment und Improvisation, Literatur und Theorie der dortigen Szene. Die Zusammenarbeit mit Musikern wie Tom Verlaine (Television) oder Kim Gordon (Sonic Youth) sind für sie als Inspiration oft wichtiger als die Arbeiten bildender KünstlerInnen. Gerade über diese scheinbaren Umwege und alternativen Energieformen hat sie sich über die Jahre eine Art Freiraum geschaffen, der in der heutigen Situation die so dringend notwendige Neubewertung des Mediums Malerei und seines Potentials ermöglicht.
Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein ist die erste große Einzelausstellung von Jutta Koether in Deutschland und zeigt erstmalig eine umfassende Auswahl aus ihrem Werk seit Mitte der Achtziger Jahre. Mit Malerei, Zeichnungen, Texten, Videoarbeiten und Installationen bespielt Jutta Koether alle Räume des Kunstvereins. Sie setzt ihre verschiedenen Ausdrucksformen miteinander in Verbindung und schafft damit Versuchsanordnungen, aus der sich eine fließende Dynamik und Offenheit entwickelt.Zur Ausstellung erscheint ein umfassender Katalog im DuMont Verlag. Texte von Diedrich Diederichsen, Isabelle Graw, Martin Prinzhorn, Michael Kerkmann und ein Gespräch mit Jutta Koether, Sam Lewitt und Eileen Quinlan erläutern die unterschiedlichen Werkbereiche Jutta Koethers. Der Katalog mit 160 Seiten umfasst ca. 160 Farbabbildungen und erscheint in deutscher und englischer Sprache.
-
Einzelausstellung: Clemens von Wedemeyer, 4.3. – 7.5.2006

“Kunst und Kino”, so Clemens von Wedemeyer, “sind verschiedene Sprachen, die miteinander verwandt sind. Ich bin an beiden Sprachen interessiert. Beide zusammen erlauben es, eine Praxis zu finden, die neue Räume für neue Untersuchungen zur Verfügung stellt.”
In seiner ersten großen Einzelausstellung zeigt Clemens von Wedemeyer Arbeiten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Mit der Auswahl der Arbeiten ortet er eine Richtung aus und stellt mit ihnen gleichzeitig Bezüge zur Architektur des Kunstvereinsgebäudes her, das zu den herausragenden Baudenkmäler der 50er Jahre zählt und sich der Kunst und dem Kino verpflichtet hat.
Exemplarisch für die Beschäftigung mit dem Kino, zeigt Clemens von Wedemeyer seine frühe filmische Arbeit “occupation” (2002). Eine große Anzahl von Statisten und eine Filmcrew treffen bei Nacht, an einem nicht näher bestimmbaren Ort aufeinander. Die Statisten reagieren verwirrt auf die missverständlichen Anweisungen des Filmteams und ebenso reagiert das Filmteam, das dennoch beschäftigt, müde und ängstlich mit aller Macht die Mittel des Kinos ausspielt. Wedemeyer hat mit “occupation” das Publikum, das Filmteam und das technische Gerät aus dem üblichen (Film-)Zusammenhang herausgelöst und es in eine absurde, an Beckett erinnernde Situation gestellt. Die Statisten werden ungewollt und unwissend zu Hauptdarstellern, das Filmteam agiert wie Marionetten nach einem ungeschriebenen Drehbuch. In der Ausstellung zeigt Clemens von Wedemeyer nun erstmals “occupation” als 35mm-Film im Kino, dessen Betrachtung auch sein Ausgangspunkt war.
Die Freistellung einer Situation und deren Transfer in einen neuen Kontext findet sich auch in der Ausstellungsgestaltung Wedemeyers wieder. Transferiert von der Kinosituation in den Ausstellungsraum, fungiert die von Clemens und Henning von Wedemeyer entworfene Ausstellungsarchitektur wie die Struktur eines Filmes. Die Ausstellungswände dienen als Trennung, als Schnitte zwischen den verschiedenen Zonen. “Im Kino”, so Wedemeyer, “ist das Trennende (der Schnitt) das Entscheidende. Fiktion entsteht als Trennung zwischen den Bereichen.”
Ortsentrückt und zeitenthoben wirkt die Videoarbeit “Silberhöhe”, obgleich ihr der Schauplatz der Hallenser Plattensiedlung “Silberhöhe” zugrunde liegt, die zwischen 1979 und 1989 für 40.000 Bewohner erbaut wurde und seit der Wende mehr als die Hälfte der Einwohner verloren hat. Die Kamera folgt den spannungsgeladenen verlassenen Straßen und Blicken in eine Musterwohnung, in der auf einem flimmernden Fernsehmonitor der Abspann von Antonionis “L´eclisse” läuft. Indem das Video Kameraführung und Schnitttechnik der Schlussszene aus Antonionis Film zitiert, transportiert es die ohne Menschen auskommende Dramatik in die aktuelle Situation des verödeten Stadtteils und schafft so eine gedankliche Linie zwischen beiden Enden der Zeitspanne, in der moderne Stadtutopie entwickelt, gebaut, gelebt und schließlich verworfen wurde.
“Otjesd” handelt von Bürokratie und dem Warten, in dem das Schicksal einer jungen Frau inmitten einer Grenzregion erzählt wird. Beide Filme erscheinen wie aus einer Zwischenwelt, in der es die Bilder nicht erlauben, sich einer Illusion hinzugeben, obwohl sie vom Dokumentarischen weit entfernt, wie ein absurdes Märchen oder ein Traum erfahren werden.
In einem Raum, den Wedemeyer zwischen die beiden Projektionsräume eingeschoben hat, wird nachvollziehbar, wie viel Fiktion vonnöten ist, um subjektive Realitäten zu vermitteln. Zu sehen sind die Entstehungsgeschichte der Filme, Wedemeyers Beschäftigung mit dem offenen, noch nicht definierten Raum an den Stadtgrenzen in Ostdeutschland, die Recherchen an den Visa-Antragstellen in Berlin und Moskau und die Beobachtungen eines realen Filmteams. Der Raum öffnet einen Ausblick auf die Stadt Köln und stellt damit auch architektonisch die Verbindung mit dem scheinbar Realen des Alltags her.
Im Untergeschoss des Kunstvereins taucht schließlich mit “Ohne Titel (Rekonstruktion)” von 2005 nochmals eine Referenz an Beckett auf. Zu sehen ist die “falsche” Rekonstruktion eines Tanzes, den Clemens von Wedemeyer bei einer Probe des Tänzers und Choreografen Alexandre Roccoli während seiner Soloarbeit in der Villa Gillet in Lyon gefilmt hat. “Ohne Titel (Rekonstruktion)” ist gleichsam eine Studie über die Bewegung im Film, in dem der Raum und der Körper elementar ins Zentrum gerückt sind und durch einen nachgearbeiteten Sound (mit Thomas Wallmann) eine unmittelbare, physische Präsenz erfährt.
Die Filmarbeiten “occupation”, “Silberhöhe” und “Otjesd” wurden vom Kameramann Frank Meyer gefilmt.
Biografische Daten
Clemens von Wedemeyer, geboren 1974, lebt und arbeitet in Berlin und Leipzig. Ausstellungen (Auswahl): PS1 Contemporary Art Center, New York (2006); Berlin Biennale, KW, Berlin (2006); CAC Brétigny-sur-Orge (2006); Galerie Meyer Rieger, Karlsruhe (2005); Kunsthalle Bremen (2005); Galerie Klosterfelde (2005); Moscow Biennale of Contemporary Art (2005); Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig (2005); Kunstwerke Berlin (2004); Galerie Jocelyn Wolff, Paris (2003).Katalog
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Texten in deutscher und englischer Sprache von Ekaterina Degot und Beatrice von Bismarck. Der Katalog wird am 05. Mai, 19 Uhr im Rahmen des Ausstellungsgesprächs präsentiert.Filmabend
Begleitend zur Ausstellung von Clemens von Wedemeyer hat Matthias Müller (Filmemacher, Bielefeld/Köln) eine Auswahl von Experimentalfilmen zusammengestellt, die am 28. April, um 19 Uhr im Kino in der “Brücke” gezeigt werden.Programm
B+W Hein, Rohfilm, D 1968
Martin Arnold, Pièce Touchée, A 1989
Morgan Fisher, Standard Gauge, USA 1984
Sharon Sandusky, C’mon, Babe (Danke Schoen), USA 1988
Manuel Saiz, Specialized Technicians Required:
Being Luis Porcar, E 2005
Christopher Giradet & Matthias Müller, Play, D 2003Ausstellungsgespräch
Alexander Koch (Kurator und Autor, Berlin) im Gespräch mit Clemens von Wedemeyer. Clemens von Wedemeyer präsentiert im Anschluss daran einen neuen Film “rien du tout” (mit Maya Schweizer).
05. Mai, 19 Uhr
-
Ausstellung: Projekt Migration, 30.9.2005 – 15.1.2006

Es ist der Blick, der darüber entscheidet, ob und wie wir Migration sehen. Die Perspektive der Nation macht aus den Menschen, die über die Grenze kommen, die Anderen: Fremde, die es zu erforschen und zu verstehen, abzuwehren und zu kontrollieren, zu nutzen und zu integrieren gilt. Ob mit empathischer Zuwendung, ökonomischem Pragmatismus oder rassistischer Ausgrenzung: Die Nation gebraucht die Anderen, um sich selbst ins Zentrum zu setzen. So entsteht die Erzählung von der Mehrheit und ihren Minderheiten.
Das Projekt Migration, das von der Kulturstiftung des Bundes initiiert wurde, steht für den Versuch, diesen Blick umzukehren und Migration als eine zentrale Kraft gesellschaftlicher Veränderung sichtbar zu machen.
Der Kölnische Kunstverein war Träger des Projektes. Projektpartner waren DOMiD – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V. für die Perspektive der Sozialgeschichte, das Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Frankfurt/Main und das Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ics, HGK Zürich) für die Perspektive der Wissenschaft.Das Projekt umfasste eine Vielzahl von Forschungsprojekten, Kunstaktionen, Veranstaltungen und Filmprogrammen. Im Fokus dieser Arbeiten standen die Geschichte der Arbeitsmigration seit den 1950er Jahren sowie die durch diese Wanderungsbewegungen ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen.
Die Ausstellung konzentrierte sich auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die durch Migration entsteht. Sie präsentierte damit ein von Migration geprägtes Deutschland und Europa. Darüber hinaus skizzierte sie aus der Betrachtung der Geschichte und der gegenwärtigen Situation die Frage nach dem zukünftigen Potenzial der Migration.
-
Einzelausstellung: Trisha Donnelly (CENTRAL-Kunstpreis), 25.6. – 4.9.2005

Zum fünften Mal vergibt die CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AG Köln in Zusammenarbeit mit dem Kölnischen Kunstverein den CENTRAL-Kunstpreis für internationale Künstler. Durch die bisherigen Preisträger Rirkrit Tiravanija (1996), Douglas Gordon (1998), Ernesto Neto (2000) und Florian Pumhösl (2002) hat der CENTRAL-Kunstpreis großes Ansehen innerhalb der bildenden Kunstszene gewonnen, das mit der Nominierung von Trisha Donnelly seine Fortsetzung findet. Trisha Donnelly wurde von einer internationalen Jury, bestehend aus Chen Y. Chaos, Chefkuratorin am Millenium Art Museum in Peking, Hans Ulrich Obrist, Kurator am Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris und Beatix Ruf, Direktorin der Kunsthalle Zürich, nominiert. Mit dem Förderpreis in einer Höhe von Euro 75.000,- setzt die CENTRAL Krankenversicherung AG ein deutliches Zeichen, neben ihrer Sammlung von zeitgenössischer Kunst auch die jüngsten Tendenzen in der zeitgenössischen bildenden Kunst wahrzunehmen und durch eine aktive Unterstützung mit fortzuschreiben.
Der CENTRAL-Kunstpreis ermöglicht der Preisträgerin einen halbjährigen Aufenthalt in Köln und die Realisierung eines neuen künstlerischen Projektes, das im Sommer 2005 in einer Ausstellung im Kölnischen Kunstverein gezeigt wird.Trisha Donnelly versteht es auf besondere Art in ihren Installationen, Video- und Soundarbeiten, Fotografien, Performances oder Zeichnungen, Momente der uneingeschränkten Konzentration und Fokussierung zu schaffen.
Beinahe obsessiv spielt sie mit einer Mischung aus Faszination und Ratlosigkeit. Durch ihre eindringlichen Demonstrationen von Kraftanstrengung und Hingabe scheint es, als sei sie in der Lage, allein durch ihren Willen die Realität zu verändern – es entsteht ein Sog von höchster Intensität. Doch statt die vormals als sicher gewähnten Situationen, die nun gebrochen und in vollkommene Irritation geraten sind, aufzulösen, lässt sie uns mit einem empfindlich treffenden Gefühl tiefer, verstörender Leere und Unsicherheit allein zurück.Trisha Donnelly erforscht in ihren Arbeiten immer wieder die Grenzen der Sinneswahrnehmung. In Soundarbeiten wie „The Shield“ (2004) setzt sie einen sonoren, dumpfen Ton, der in regelmäßigen Abständen ertönt, in einer so hohen Stärke ein, dass er zu einer körperlich spürbaren Barriere wird. Das was uns eigentlich Immateriell erscheint, wird nun zum architektonischen Element, das ganze Raumteile voneinander zu trennen vermag – dessen Wirkung sich allerdings erst im Besucher selbst entfaltet. Ihre Fotoarbeit „The Black Wave“ (2002) zeigt die Aufnahme einer Welle. Die unbändige, aber gleichermaßen auch verborgene Kraft, die darin sichtbar anschwillt, lässt an ein Unwetter, an Regen oder Sturm denken – es gibt allerdings keinerlei Hinweis, der die Situation auflösen würde. So ist es das Ephemere, Beiläufige, das in Trisha Donnellys Arbeiten eine besondere Rolle spielt, wenn sie bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in der Casey Kaplan Galerie in New York als ein Napoleonischer Bote auf einem Pferd reitend, erscheint, und der erstaunten Menge die Kapitulation Napoleons verkündet, bevor sie ihr Pferd wieder wendet und in die Nacht New Yorks hinausreitet. Diese Aktionen, von Trisha Donnelly selbst als „Demonstrationen“ bezeichnet, werden weder filmisch noch schriftlich dokumentiert. Sie finden ihre Verbreitung lediglich durch die mündlichen Erzählungen derjenigen, die Trisha Donnellys Aktion miterlebt haben.
Trisha Donnelly lässt uns mit ihren Arbeiten in unserer Imagination über das, was wir auf den ersten Blick zu erkennen glauben, hinaus gehen. So ergibt sich ein stetiges Wechselspiel zwischen physikalischem und imaginiertem Raum, zwischen Realität und Fiktion. Sie wirft uns damit auf die profunde Frage zurück, worüber wir uns eigentlich sicher sein können – worauf wir unsere Existenz begründen. Dies schafft sie auf eine mitreißende Weise, die in ihrer Stärke und Bedingungslosigkeit einzigartig ist.
Für ihre erste große Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein hat Trisha Donnelly neue Arbeiten produziert, die sie in einer eigens entworfenen Ausstellungsarchitektur präsentiert. Die ausgestellten Zeichnungen, Filmaufnahmen, Soundarbeiten und Fotografien sind fast ausschließlich während ihres halbjährigen Aufenthaltes in Köln entstanden und resultieren auch aus ihrer Beschäftigung mit dem Ausstellungsort, seiner Geschichte und Bedeutung.
-
Einzelausstellung: Cezary Bodzianowski – Ein und Aus, 18.2. – 1.5.2005

Der polnische Künstler Cezary Bodzianowski, der erst kürzlich mit dem renommierten polnischen Kunstpreis (Polityka) ausgezeichnet wurde, ist ein ungewöhnlicher Künstler, der ausserhalb Osteuropas noch wenig bekannt ist. Ein Grund dafür liegt in der Widerständigkeit, mit der sich seine künstlerische Arbeit den Erwartungen wie auch Vereinnahmungs- und Kategorisierungstendenzen einer international zunehmend an den Gesetzmäßigkeiten des Kunstmarktes orientierten Ausstellungspraxis verweigert.
Diese Verweigerung findet ihren Ausdruck nicht nur in seiner Wahl der performativen Intervention als bevorzugtes künstlerisches Medium. Der Flüchtigkeit des gewählten Mediums entspricht auch die Flüchtigkeit der Aktionen bzw. der Situationen, die er damit schafft. Manche seiner Interventionen bleiben völlig unbemerkt, andere haben zufällige Beobachter, selten richten sie sich an ein Publikum, das sie – vorab informiert – erwartet und in einen Kunstkontext bringen kann. Die Grundregeln der Performance gelten für Bodzianowskis Arbeit nicht. Er hat keine Bedenken wegen der Dauer, keine Angst vor langen Passagen, kümmert sich nicht um das Publikum oder um ein möglichst aufsehenerregendes Finale. Die zahllosen Aktionen laufen fast ausschließlich vom Kunstbetrieb unbeobachtet ab und eben auch unabhängig von ihm, gleichsam als Ausdruck einer täglichen künstlerischen Notwendigkeit. Ihnen gemeinsam ist die absichtliche Beschränkung auf einfachste Mittel, die auch das spontane Reagieren auf Vorgefundenes ermöglicht. In „Good Morning“ (Lodz, 1997) etwa, hat der Künstler den Fahrer eines Kranwagens, auf den er um 7 Uhr morgens bei einem Spaziergang gestoßen war, überredet, ihn im Krankorb zu den Fenstern im 5. Stock eines Sozialbaus emporzuheben. Er klopfte an die Fenster, weckte so die Bewohner, grüßte sie und empfahl seine morgendlichen Grüße an die anderen Mitbewohner.
Besondere Beispiele für die poetisch-subversiven Interventionen wie auch für seine Skepsis gegenüber gängigen Ausstellungspraktiken finden sich in Beiträgen zu Ausstellungen, zu denen er eingeladen wurde. So hat sein Ausstellungs-beitrag in einer Galerie in Lublin 1997 darin bestanden, die Angestellten zu überreden, sich während der Öffnungszeiten in der Galerie einschliessen zu lassen, die Computer und die Telefone auszustecken und ihre Arbeit einzustellen. Während-dessen unternahm der Künstler einen ausgedehnten Spaziergang durch die sonnigen Straßen von Lublin. Ein anderes Mal (‚Nattahnam’, Galeria Manhattan, 1996) bestand der Ausstellungsbeitrag des Künstlers darin, einen Tag in der Wohnung über der Galerie gemeinsam mit der dort lebenden Familie zu verbringen und sich bestmöglich in ihren Alltag einzufügen.
Gemeinsam ist den Interventionen Cezary Bodzianowskis die Überwindung von ‚natürlichen’ Sinnzusammenhängen, wie sie Gewohnheit und Routine zwingend vorgeben. Die Behauptung alternativer Lesarten von scheinbar Gesichertem birgt dabei in einer Gesellschaft, deren Selbstverständnis maßgeblich von der Eindeutigkeit und Zweifellosigkeit dessen getragen wird, worauf man sich allgemein als wahr geeinigt hat, subversives Potential in sich. Dieses subversive Potential wird zwar durch die große Poesie der Interventionen überlagert, schreibt sich aber dem kritischen Bewusstsein eben erst durch diese immanente poetische Bildhaftigkeit nachdrücklich und unauslöschlich ein.
Die meisten Interventionen und Aktionen Cezary Bodzianowskis hat seine Frau, die Fotografin Monika Chojnicka, mit einfachen Erinnerungsfotos dokumentiert. Als Teil der Ausstellung im Kunstverein wird erstmals eine Auswahl dieser Dokumentationen, die von großer poetischer und bildhafter Ausstrahlungskraft sind, zu sehen sein. Cezary Bodzianowski wird die Dokumentationen am Freitag, den 18.2. um 19.30 Uhr und am Samstag, den 19.2. um 18 Uhr in einer Performance kommentieren.
Cezary Bodzianowski, geboren 1968, lebt und arbeitet in Lodz, Polen.
-
Ausstellung: Jahresgaben 2004, 1. – 23.12.2004

-
Einzelausstellung: Cosima von Bonin – 2 Positionen auf einmal, 29.10.2004 – 16.1.2005

2 Positionen auf einmal nennt Cosima von Bonin ihre Ausstellung im Kölnischen Kunstverein – ihre erste große Einzelausstellung in einer Kölner Kunstinstitution. 2 Positionen auf einmal sind eigentlich 300 Positionen oder mehr: Die Ausstellung vereint gleichwertig Installationen, Bilder, Objekte, Performances und Filme, handelt von einer Vielzahl von Geschichten und sozialen Beziehungen zu anderen Künstlern und Musikern, von individuellen Erinnerungen und der Absage an die Idee des vereinzelten Künstlersubjekts.
Gemeinsam mit Freunden hat Cosima von Bonin während des Ausstellungsaufbaus einen von ihr entworfenen objektartigen Raum als Set für Performances und Fotoshootings verwendet. Diesen Spielort hat die Künstlerin als einen Holzcontainer und seltsam anmutendes Behältnis für Wohnwelten konzipiert, in dem während einer Performance Menschen mit Tiermasken, ihre Hunde, ein mit Stoff ummantelter Katamaran und eine Gruppe junger Menschen in improvisierten aber auch in vorher festgelegten Szenen miteinander verwickelt wurden. Alle Akteure tragen von Kazu Huggler entworfene Mode aus der kommenden Frühjahr-/Sommerkollektion chidori. Die Musik stammt von der Gruppe Phanom/Ghost (Dirk von Lowtzow und Thies Mynther).
Durch die performative Inszenierung hat der Ort eine narrative Aufladung erfahren, obwohl die Spuren der Akteure nach der Performance dem Besucher wie weggewischt erscheinen. Entstanden ist daraus ein Film, der in der Ausstellung gezeigt wird und die Vorgänge der Performance neu miteinander vereint.Wie Anspielungen funktionieren auch die Bilder und Arbeiten im anderen Ausstellungsraum, die einen umfassenden Einblick in Cosima von Bonins Arbeitsweise der letzten Jahre geben. Es scheint als wären auch sie Teile einer Handlung und erzählten von verschiedenen individuellen und kollektiven Geschichten. Zugleich beanspruchen die einzelnen Objekte aber auch ihre Autonomie durch ihre aus dem Zusammenhang der Installation losgelösten starken bildnerischen Qualitäten. Es entstehen modellhafte, poetische Räume, voller Verweise und komplexen Beziehungssystemen aus Erinnerungen und Assoziationen, die Cosima von Bonin im Kölnischen Kunstverein konstruiert und in denen auch ihr eigener sozialer Rahmen zum Gegenstand der Kunst wird.
In der Ausstellung beteiligt sind neben der Züricher Modedesignerin Kazu Huggler und der Musikgruppe Phantom/Ghost weitere Künstlerfreunde von Cosima von Bonin, wie Ulla von Brandenburg, Nina Braun, Julia Horstmann, Tellervo Kalleinen, Annette Kelm, Almut Middel, Thomas Ritter, Roman Schramm, Hanna Schwarz, Dejan Mujicic, Jörg Schlürscheid, Akiko Bernhöft, Manfred Hermes und Da Group.
Im Verlag der Buchhandlung Walther König erscheint ein von Cosima von Bonin und Yvonne Quirmbach gestalteter Katalog. In einer losen Abfolge von Szenen dokumentiert er in zahlreichen großformatigen Abbildungen die Installation und Performance, die während des Ausstellungsaufbaus stattgefunden hat. Die Abbildungen werden von einem Text von Manfred Hermes begleitet. Der Katalog mit ca. 140 Seiten, erscheint in deutscher und englischer Sprache und umfasst ca. 200 Farbabbildungen.
Während der Ausstellung zeigt das Kölner Modegeschäft „Heimat“ Filme von Pariser Modeschauen im Kino in der „Brücke“. Zu sehen sein wird „die Quintessenz der Mode, jenseits der üblichen Catwalks. Zehn Designer, zehn Shows. In ungekürzter Form und sonst nur einem Fachpublikum vorbehalten…“ (Andy Scherpereel und Andreas Hoyer).
-
Ausstellung: Deutschland sucht..., 17.7. – 19.9.2004

KünstlerInnen: Nevin Aladag, Thomas Bayrle, Henning Bohl, Heike Bollig, Ulla von Brandenburg, Andreas Brehmer/Sirko Knüpfer, Michael Buthe, Helmut Dorner, Jeanne Faust, Julika Gittner, Asta Gröting, Niels Hanisch, Myriam Holme, Viola Klein, Seb Koberstädt, Michael Krebber, Svenja Kreh, Kalin Lindena, Daniel Megerle, Anna Kerstin Otto, Manfred Pernice, Marion Porten, Mandla Reuter, Evelyn Richter, Eske Schlüters, Stafeta, Lee Thomas Taylor, Stefanie Trojan, Danh Vo, Gabriel Vormstein, Clemens von Wedemeyer, Herwig Weiser, Tobias Zielony, Zupfgeigenproduktion.
Ausgewählt von: Ariane Beyn (Berlin), Anja Dorn (Köln), Peter Gorschlüter (Düsseldorf), Iris Kadel (Karlsruhe), Chistiane Mennicke (Dresden), Nina Möntmann (Hamburg), Vanessa Joan Müller (Frankfurt am Main), Julia Schäfer (Leipzig), Judith Schwarzbart (München)
Die Ausstellung Deutschland sucht will einen Einblick in gegenwärtige Tendenzen junger Kunst in Deutschland geben und sich dabei kritisch mit dem Format der Überblicksausstellung auseinandersetzen. Mit der Absicht einen möglichst weiten und offenen Rahmen zu schaffen, sind KuratorInnen aus verschiedenen Regionen Deutschlands eingeladen worden, jeweils drei junge Künstler zu benennen, die in der Kunstöffentlichkeit wenig bekannt oder noch nicht etabliert sind, deren Arbeiten jedoch als signifikant für aktuelle Entwicklungen in der zeitgenössischen Kunst bezeichnet werden können. Die KuratorInnen haben darüber hinaus jeweils eine etablierte Position als (historische und/oder künstlerische) Referenz vorgeschlagen, die zu einer Klärung der gewählten Zugänge beitragen kann. Die konzeptuelle Offenheit der Ausstellung, der Generationen übergreifende Ansatz sowie das Fehlen jeglicher ausschließenden thematischen Festlegung lassen die Berücksichtigung unterschiedlicher künstlerischer Positionen zu, deren gemeinsame Ausstellung eine Diskussion von Übereinstimmungen und Differenzen ermöglichen soll.
Der Ausstellungstitel Deutschland sucht verweist auf die politische und gesellschaftliche Gegenwart Deutschlands und will den Kontext aufzeigen, in dem zurzeit in Deutschland Kunst entsteht bzw. entstanden ist. Nicht nur ökonomisch und politisch, sondern auch mental scheint Deutschland gegenwärtig auf der Suche nach seiner Rolle in einer sich grundlegend verändernden Welt. Diese Identitätssuche spiegelt sich derzeit auch verstärkt in diversen Fernsehsendungen, Zeitungskommentaren und Diskussionen wider. Vor diesem Hintergrund stellt „Deutschland sucht“ die Frage, ob sich neue Entwicklungen, Themen und Arbeitsweisen in der aktuellen Kunstproduktion in Deutschland abzeichnen und wie diese von einer Generation jüngerer KuratorInnen wahrgenommen werden.
Gezeigt werden 40 künstlerische Positionen, die sich sowohl aus verschiedenen Medien wie Malerei, Installation, Film, Fotografie und Objekt, als auch aus sehr unterschiedlichen inhaltlichen und konzeptuellen Überlegungen entwickeln.
Die Ausstellung wurde von Jens Hoffmann (Director of Exhibitions ICA, London) und Kathrin Rhomberg (Kölnischer Kunstverein) konzipiert.
Deutschland sucht wurde durch die großzügige Unterstützung der Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Iserlohn ermöglicht. Seit 1996 dokumentiert Dornbracht, international agierender Hersteller von Design-Armaturen, -Accessoires und Interiors, regelmäßig sein Selbstverständnis als Unternehmen mit kultureller Kompetenz. Das Kulturengagement gliedert sich in drei Bereiche: Die limitierten Statements Ausgaben versammeln vielschichtige Interpretationen von Badritualen und Badkultur und bieten den beteiligten Künstlern ein internationales Forum. Die Arbeiten werden in wechselnder medialer Form dokumentiert und international in Ausstellungen und Galerien präsentiert. Im Rahmen der Dornbracht Installation Projekts, einer jährlich stattfindenden Ausstellungsreihe, die künstlerische Positionen im Bereich Installation präsentiert, startete 2000 die Kooperation mit dem Kölnischen Kunstverein. Mit dem Dornbracht Sponsorship fördert das mittelständische Unternehmen darüber hinaus internationale Ausstellungen und Projekte und reiht sich mit finanziellem und personellem Engagement ein in die Riege internationaler Kunstförderer. So sponserte Dornbracht 1999 und 2001 den deutschen Pavillon anlässlich der Biennale von Venedig.
-
Einzelausstellung: Roman Ondak – Spirit and Opportunity, 1.5. – 27.6.2004

„Als Zeichen Ihrer Solidarität mit den jüngsten Ereignissen in der Welt, bitten wir Sie, die Tätigkeit, die Sie gerade ausüben, für die nächste Minute nicht zu unterbrechen.“
Beim Besuch einer Gruppenausstellung hörten Museumsbesucher diese Mitteilung in regelmäßigen Abständen. Offensichtlich hatte ein Museumswärter sein Radio auf einen Sender gestellt, dessen Sprecher mit osteuropäischem Akzent den Satz von Roman Ondák wiederholt in die aktuellen Nachrichten eingeflochten hat.
Den Museumsbesuchern erschien die Mitteilung mit dem Titel „Announcement“ (2002) wie eine plötzliche Unterbrechung des Museumsalltags. Sie wurde als Aufforderung verstanden, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten und durch diesen performativen Akt selbst Teil der Ausstellung zu werden. Dieses Spiel mit Bedeutung, Kontext und Imagination ist eines der zentralen Momente in Ondáks künstlerischem Denken.
Roman Ondák entwickelt dabei eine große Intimität zu Menschen, die als Betrachter oder Akteure an ihnen beteiligt sind.Für „Antinomads“ (2000) hat Roman Ondák Freunde, Verwandte und Bekannte, die nicht reisen wollen, in ihrer privaten Umgebung fotografiert. Diese Aufnahmen wurden als Postkarten vervielfältigt und in Ausstellungen zur freien Entnahme angeboten. Wie alle anderen Postkarten auch, wurden sie von Touristen erworben und in die ganze Welt versendet. Die „Antinomads“ wurden damit auf paradoxe Weise zu Weltreisenden, indem Ondák dem zeitlichen und örtlichen Stillstand eine neue Handlungsoption entgegensetzt, die beides in sich vereint, Ortsverbundenheit und Mobilität.
Als ein genauer Beobachter unserer Realität hält Ondák seine alltäglichen Wahrnehmungen in Form von Zeichnungen und Notizen fest, aus denen er seine künstlerischen Interventionen entwickelt, die durch Kontextverschiebungen und poetisch anmutende Inszenierungen in die reale Welt zurückwirken. Mittels eines ständigen und widersprüchlichen Transfers von Bedeutungen, dem Einführen unerwartet Handelnder in einen mit Erwartungen voll geschriebenen Ort oder der Wiederholung desselben Bildes in verschiedenen Medien setzt er unserem gewohnten Gleichgewicht von Wahrnehmungsprozessen ein empfindlich störendes Gegengewicht hinzu und entlarvt dadurch unsere mühsam austarierte Balance kollektiver Konstruktionsprozesse von Inhalt, Bedeutung und den damit verknüpften Emotionen. Roman Ondák arbeitet dabei mit unterschiedlichsten künstlerischen Medien, wie Zeichnung, Performance, Skulptur oder Installation.
Für seine Ausstellung im Kölnischen Kunstverein – Roman Ondáks erster großer Einzelausstellung – entwickelt er eine skulpturale In-situ-Arbeit. Auch hier entsteht ein Erfahrungsraum voll von Verschiebungen, Schwellen und unerwarteten Ausblicken. Er stellt der Wirklichkeit seinen eigenen Gegenentwurf einer Welt gegenüber, der zum poetisch anmutenden Schauplatz geheimer, unvorhersehbarer, zufälliger Verhaltensweisen und kollektiver Sehnsüchte wird. Der Ausstellungsraum nimmt die Materialität eines Raumobjekts an, das wie ein Fremdkörper in die Wirklichkeit hineingeschoben wirkt, gleichzeitig aber untrennbar von ihr ist.
Erstmalig erscheint zur Ausstellung eine umfassende monografische Publikation mit Arbeiten von Roman Ondák seit den 90er Jahren. Die Textbeiträge sind von Georg Schöllhammer, Igor Zabel und Hans Ulrich Obrist in deutscher und englischer Sprache.
-
Einzelausstellung: Ann-Sofi Sidén – Warte mal!, 14.2. – 8.4.2004

Ann-Sofi Sidén beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der Absurdität des Normalen und Alltäglichen. In Arbeiten wie „Who Has Enlarged This Hole?” (1994) und „Who Told the Chambermaid?” (1999) beleuchtet sie die menschliche Psyche mit ihren Versuchen, einander widersprechende Forderungen von Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnissen zu bewältigen. Die Sphären der sozialen und ökonomischen Aktivitäten entpuppen sich dabei oftmals als besonders geeignete Operationsfelder, um das eigentlich verborgene Gesicht menschlicher Realität aufzudecken. So auch in ihrer Arbeit „Warte Mal!”, die sie im Kölnischen Kunstverein zeigt.
„Warte Mal!” ist eine Videoinstallation, in der Ann-Sofi Sidén den Besucher mit dem Ort Dubi, an der deutsch-tschechischen Grenze, konfrontiert. An dieser geopolitischen Schnittstelle entwickelte sich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und nach Öffnung der Grenzen 1989 ein neuer Wirtschaftszweig: die Massenprostitution. Hunderte von Mädchen aus ganz Osteuropa arbeiten hier als Prostituierte und versuchen, die meist deutschen, vorbeifahrenden Autos anzuhalten, indem sie ihnen „Warte Mal!” hinterher rufen – oft die ersten deutschen Worte, die die Mädchen lernen.Ann-Sofi Siden ist 1999 aus Neugierde und Interesse in diese Region gefahren, hat sich dort über einen Zeitraum von neun Monaten aufgehalten, und mit ihrer Handkamera ein dichtes Porträt erstellt, das sich aus verschiedenen filmischen Komponenten zusammensetzt: Wir sehen Interviews mit Prostituierten, Zuhältern, Polizisten und lernen ein Ehepaar kennen, das in ihrem Motel die Zimmer stundenweise an die Mädchen und ihre Kunden vermietet. Dabei lässt Ann-Sofi Sidén den Besucher stets durch „ihre Augen” sehen, was eine große Intensität zur Folge hat. Daneben präsentiert uns die Künstlerin eine Projektion, wie die Mädchen ihre potenziellen Kunden auf der Strasse anzulocken versuchen, ihr Tagebuch, zeigt verschiedene Landschaftsaufnahmen und Filmstills, wie sie die Mädchen sieht, mit ihnen feiert und lebt.
Innerhalb der Arbeit entsteht ein narrativer Zirkelschluss der individuellen Lebensgeschichten. Wir erfahren von Hoffnungen, Enttäuschungen und Erwartungen der Interviewpartner und schnell wird deutlich, wie verstrickt und abgründig die menschlichen Beziehungen, Abhängigkeiten und Hierarchien der Interviewten untereinander sind. Durch ihren internen Report ermöglicht es uns Sidén, in eine scheinbar ganz eigene, abgeschlossene Welt abzutauchen, fernab von unserem gewohnten sozialen Mikrokosmos. Sie lässt uns einen intimen Einblick in eine geheime Welt nehmen, die sonst im Verborgenen bleibt.
Dabei nimmt Ann-Sofi Sidén stets eine eher beobachtende Perspektive ein, die zwar einen drastischen Konfrontationskurs einschlagen kann aber niemals moralisiert oder verurteilt. Vielmehr liegt es am Betrachter, zu beobachten und zu reagieren. Sidén spielt mit dem Besucher, der seine „sichere Rolle” unweigerlich verlassen muss. Einerseits fühlt er sich zwar als Voyeur, doch gleichzeitig ist er schon in den Bann des Verborgenen gezogen und wird damit zum Partizipient. Sie nutzt die Freiheit der Kunst, um den Zuschauer mit einer bis dahin unbekannten, geheimen Realität zu konfrontieren, die ihn automatisch dazu bewegt, Position zu beziehen,
wenn er den Einzelschicksalen der teilweise bewegenden, unscheinbaren oder abstoßenden Charaktere lauscht.
Sidén arbeitet mit einem dokumentarischen Verfahren, das sie jedoch durch architektonische,
bildhauerische, fotografische und performative Dimensionen zu einer vielschichtigen konzeptuellen Gesamtheit erweitert. Dabei werden die filmischen Komponenten in einer Raumarchitektur zueinander in Wechselwirkung gesetzt, sodass die vielfältigen formalen Ausdrucksformen in Interaktion treten und ein Netz unterschiedlicher Perspektiven und Blickpunkte entsteht.Durch diese Strategie der Vernetzung und die bewusst beiläufige Bildsprache gelingt es ihr, die Zeichen- und Zeitdimension der Medien, des Fernsehfilms und des Kinos zu unterlaufen, die sich auf Sekundenblicke konzentrieren, um eine technisch perfekte Wirklichkeitsillusion zu erzielen. Sidéns Arbeit zeichnet sich vielmehr durch eine unmittelbar wirkende Ästhetik aus, die einer malerischen Auffassung vergleichbar ist und Entdeckung bzw. Kunstgriff zugleich ist.
Die Ausstellung wird im Zusammenhang mit dem von der Kulturstiftung des Bundes initiierten Projekt Migration präsentiert und erstmals in Deutschland gezeigt. „Warte Mal!” war 1999/2000 in der Secession in Wien sowie 2002 in der Hayward Gallery in London zu sehen. Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein ist eine Weiterführung der Arbeit, für die Ann-Sofi Sidén eine neue Ausstellungsarchitektur entwickelt hat.
„Warte Mal!” von Ann-Sofi Sidén bietet die Möglichkeit einer ersten künstlerischen Begegnung mit dem Thema Migration, das den programmatischen Schwerpunkt des Kunstvereins im Jahr 2005 bilden wird.
Biographie
Ann-Sofi Sidén wurde 1962 in Stockholm geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
Ausstellungen (Auswahl): Musée d´Art de la Ville de Paris (2001); Berlin Biennale (2001); Villa Arson, Nice (2000); Venice Biennale (1999), Secession, Vienna (1999); “Nuit Blance”, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1998), Biennale de São Paolo (1998); “Zonen der Verstörung”, Steirischer Herbst (1997); “See What it Feels Like”, Rooseum, Malmö; Galerie Nordenhake, Stockholm (1995); “P.S. 1. Studio Artists 194″, P.S. 1, New York (1994).
-
Ausstellung: Jahresgaben 2003, 17.12.2003 – 25.1.2004

-
Einzelausstellung: Florian Pumhösl (CENTRAL-Kunstpreis), 11.10. – 14.12.2003

-
Einzelausstellung: Julius Koller – Univerzálne Futurologické Operácie, 19.7. – 21.9.2003

Július Koller hat „bis heute ein Werk und eine Position entwickelt, das in seiner Stringenz, Obsession und Eigenart eines der wohl erratischsten und konsequentesten der europäischen Gegenwartskunst zu nennen ist. Am ehesten vielleicht noch mit dem Universum eines Marcel Broodthaers vergleichbar”. (Georg Schöllhammer)
Die international erste, umfassende Einzelausstellung von Július Koller im Kölnischen Kunstverein handelt von Versuchen utopischer Raumaneignung im Bemühen um neue Kreativität, Imagination und größere Freiheit. Sie ist gemeinsam mit dem jungen Künstler Roman Ondák konzipiert worden, der 2004 selbst mit einer Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein vertreten sein wird.
Július Koller versteht seine künstlerische Praxis seit Mitte der 60er Jahre als einen „kulturellen Prozess”, in dem die Eigeninitiative des Subjektes, das zukunftsorientierte, kulturelle Situationen gestalten sollte von besonderer Bedeutung ist. Mit seinen Projekten hat er eine solche schrittweise, aktive Veränderung der Wirklichkeit in die Realität eingeschrieben.Július Koller, geboren 1939 in Piestany (ehem. Tschechoslowakei) lebt und arbeitet in Bratislava.
-
Ausstellung: Wir müssen heute noch an Ihr Vorstellungsvermögen appellieren…, 9.5. – 22.6.2003

…um im Namen der Kunst vor- und rücksichtslos den Raum zu behaupten, in den Sie oder wir uns gedrängt haben. Mit welchem Recht fragen Sie jetzt sicherlich.
Kamal Aljafari, Cezary Bodzianowski, Josef Dabernig, Halt+Boring, Sanja Ivekovic, Thomas Kilpper, Július Koller, Jiri Kovanda, Josh Müller, Roman Ondák, Anatoly Osmolovsky, rasmus knud, Hans Schabus, Werner Würtinger, Heimo Zobernig
Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Vergabe der „Brücke” an den Kölnischen Kunstverein thematisiert die Ausstellung Ansprüche, die Kunst erhebt, und stellt Fragen nach den Wirkungsmöglichkeiten und der gesellschaftlichen Relevanz von Kunst.
Kann Kunst der Imagination Freiräume für Ideen, Überzeugungen und Erkenntnisse öffnen, die wir noch gar nicht kennen? Welchen Raum braucht die Kunst, durch welche Qualitäten zeichnet er sich aus, welche Einflüsse übt er auf die Wahrnehmung, auf Denken und Handeln aus? Kann Kunst Widerstand gegen die Regime der Gewöhnung sein und Haltungen und Strategien entwickeln, die jeder kritiklosen Anpassung an vermeintliche Unabänderlichkeiten widersprechen?
-
Ausstellung: Jahresgaben 2000, 28.10. – 22.12.2000

-
Einzelausstellung: Michel Majerus – If we are dead, so it is, 28.10. – 22.12.2000

-
Ausstellung: Cildo Meireles/Lawrence Weiner – The Southern Cross/As far as the eye can see, 19.8. – 1.10.2000

-
Ausstellung: Schnitt Ausstellungsraum – Out of Space, 13.5. – 2.7.2000

-
Ausstellung: Edward Ruscha, Julius Shulman, James Welling – light-heeled, light-handed, 5.2. – 9.4.2000

-
Ausstellung: Jahresgaben 1999, 30.10. – 23.12.1999

-
Ausstellung: OBSESSION, 30.10. – 23.12.1999

-
Einzelausstellung: Stanley Kubrick – Still Moving Pictures, 4.9. – 10.10.1999

-
Einzelausstellung: Christian Jankowski – telemistica, 4.9. – 10.10.1999

-
Einzelausstellung: Britta Wandaogo – Bilfou Biga – den Affen töten, 26.6. – 8.8.1999

-
Einzelausstellung: Dorothee Golz – Der Traum vom großen roten Fleck, 26.6. – 8.8.1999

-
Einzelausstellung: Douglas Gordon – Feature Film, 10.4. – 30.5.1999

-
Einzelausstellung: Marcel Odenbach – Ach, wie gut, daß niemand weiß, 6.2. – 21.3.1999

-
Ausstellung: h:min:sec – Eine Ausstellung zur Zeit, 24.10. – 23.12.1998

-
Einzelausstellung: Mischa Kuball – project rooms: kaleidoscope, 25.7. – 13.9.1998

-
Einzelausstellung: Martin Gostner – Erinnerung weich, 25.7. – 13.9.1998

-
Einzelausstellung: Lucas Fairhurst – Odd Bod Photography, 21.5. – 1.7.1998

-
Einzelausstellung: Peter Zimmermann – Eigentlich könnte alles auch anders sein, 21.5. – 1.7.1998

-
Ausstellung: Arte Povera – Sammlung Goetz, 14.2. – 26.4.1998

-
Ausstellung: ca-ca poo-poo, 8.11.1997 – 11.1.1998

-
Einzelausstellung: Thomas Grünfeld – Déformation Professionelle, 1. – 19.10.1997

-
Ausstellung: PopVideo – in Zusammenarbeit mit VIVA 2, 17.8. – 21.9.1997

-
Einzelausstellung: Beuys will be Beuys – Ein Videoprogramm, 22.5. – 22.6.1997

-
Einzelausstellung: Atelier van Lieshout – Hausfreund, 17.5. – 12.7.1997

-
Einzelausstellung: Antony Gormley – Total Strangers, 23.2. – 13.4.1997

-
Einzelausstellung: Rirkrit Tiravanija – Untitled, 1996 (tomorrow is another day), 6.11.1996 – 2.1.1997

-
Einzelausstellung: Jörg Sasse – Was man übrigens sehr selten sieht, sind Schwarzweissfotos von Erdbeeren, 7.9. – 13.10.1996

-
Einzelausstellung: Carsten Höller – GLÜCK, 1.6. – 21.7.1996

-
Einzelausstellung: Tobias Rehberger – Peuè Seè e Faàgck Sunday Paàe, 2.3. – 21.4.1996

-
Einzelausstellung: Öyvind Fahlström – Installationen, 2.3. – 21.4.1996

-
Einzelausstellung: Sery C. – Kölner Bilder. Lock up, 26.1. – 25.2.1996

-
Ausstellung: Palast der Künste, 1995, 9.11. – 21.12.1995

-
Einzelausstellung: On Kawara – Erscheinen-Verschwinden, 26.8. – 8.10.1995

-
Einzelausstellung: Formationen der unmittelbaren Raumstörung – Teil 1, 27.6. – 6.8.1995

-
Einzelausstellung: Vadim Zakharov – Spaziergang durch die Elysischen Felder, 24.6. – 6.8.1995

-
Ausstellung: Zeichnung und Raum – ars viva 94/95, 7.4. – 21.5.1995

-
Einzelausstellung: Robert Smithson – Hotel Palenque, Spiral Jetty, 7.4. – 21.5.1995

-
Einzelausstellung: David Reed, 27.1. – 19.3.1995

-
Ausstellung: Blast 4 - Bioinformatica, 27.1. – 19.3.1995

-
Ausstellung: Der Stand der Dinge, 28.10. – 23.12.1994

-
Ausstellung: Kabinettausstellung – Kanal X, 5.9. – 17.10.1994

-
Einzelausstellung: Julia Scher – Don’t Worry, 21.8. – 2.10.1994

-
Einzelausstellung: Robert Irwin – Retroperspektive, 10.4. – 12.6.1994

-
Einzelausstellung: Carl Andre – Words, 1958-1972, 16.1. – 27.2.1994

-
Einzelausstellung: Thomas Locher – Wer sagt was und warum?, 8.11. – 20.12.1992

-
Einzelausstellung: Alan Uglow, 19.9. – 1.11.1992

-
Ausstellung: Fluxus Virus, 1. – 27.9.1992

-
Ausstellung: Exkursion, 11.07.1992

-
Einzelausstellung: Josef Albers, 24.5. – 19.7.1992

-
Ausstellung: Arbeiten auf Papier 1945-1975 – Donation für Busch-Reisinger, 6.4. – 3.5.1992

-
Einzelausstellung: Ilya Kabakov – Das Leben der Fliegen, 2.2. – 29.3.1992

-
Einzelausstellung: Martin Kippenberger – Heavy Burschi, 10.11. – 22.12.1991

-
Ausstellung: Endre Tót – Zeichnungen, 10.11. – 22.12.1991

-
Einzelausstellung: Günter Tuzina – Wandarbeiten und Arbeiten auf Papier 1975-1991, 8.9. – 20.10.1991

-
Ausstellung: Kunst, Europa 1991 – Island, 7.7. – 18.8.1991

-
Ausstellung: Ines Hock – Gemälde, 28.4. – 16.6.1991

-
Einzelausstellung: Christopher Wool – Bilder, 28.4. – 16.6.1991

-
Einzelausstellung: Michael Scholz, 16.3. – 14.4.1991

-
Einzelausstellung: Ross Bleckner, 13.1. – 24.2.1991

-
Ausstellung: Aus meiner Sicht – Eine Ausstellung von Rolf Ricke, 12.11.1989 – 7.1.1990

-
Ausstellung: Landschaft in der Erfahrung, 7.9. – 22.10.1989

-
Ausstellung: Jubiläums-Ausstellung – Vom Maler Bock zur schönen Gärtnerin, 11.5. – 13.8.1989

-
Ausstellung: Video-Skulptur – retrospektiv und aktuell, 1963-1989, 17.3. – 23.4.1989

-
Ausstellung: Erste Ausstellung, 22.1. – 26.2.1989

-
Einzelausstellung: Joseph Fassbender, 11. – 31.12.1988

-
Ausstellung: Arbeiten mit Photographie aus Köln – Sammlung F.C. Gundlach Hamburg, 13.11.1988 – 4.12.1989

-
Ausstellung: Bauhaus-Utopien – Arbeiten auf Papier, 15.6. – 11.9.1988

-
Ausstellung: Vom Himmel auf die Welt zur Hölle, 5. – 26.6.1988

-
Ausstellung: Für eine Welt ohne Hunger, 21.4. – 29.5.1988

-
Einzelausstellung: Anna und Bernhard Blume – Trautes Heim. Fotos aus dem wirklichen Leben, 4.3. – 10.4.1988

-
Einzelausstellung: Giulio Paolini – Giorno e Notte, 23.1. – 21.2.1988

-
Einzelausstellung: Graham Nash, 11.12.1987 – 10.1.1988

-
Ausstellung: Kunst im Fernsehen, 5. – 22.11.1987

-
Ausstellung: Weltmusiktage, 24.10. – 22.11.1987

-
Ausstellung: buchstäblich wörtlich, wörtlich buchstäblich, 24.10. – 22.11.1987

-
Einzelausstellung: Arthur Segal – Retrospektive, 6.9. – 18.10.1987

-
Einzelausstellung: Sala, 23.8. – 23.7.1987

-
Einzelausstellung: Ulrich Rückriem – Skulpturen, 24.5. – 5.7.1987

-
Einzelausstellung: Ewald Matare, 4.3. – 3.5.1987

-
Ausstellung: Bauhaus-Fotografie, 15.1. – 15.2.1987

-
Einzelausstellung: Markus Raetz, 7. – 30.12.1986

-
Ausstellung: Kölns Weg zur Kunstmetropole – Die 60er Jahre, 31.8. – 16.11.1986

-
Ausstellung: Unausgewogen, 8.6. – 17.7.1986

-
Ausstellung: Sieben Skulpturen, 23.4. – 1.6.1986

-
Ausstellung: Infermental, 9. – 13.4.1986

-
Ausstellung: Acht in Köln, 20.2. – 31.3.1986

-
Ausstellung: Von Maurice Chevalier bis zum Nierentisch – Die Sammlung Hermann Götting, 5.12.1985 – 26.1.1986

-
Ausstellung: Performance 1985 – Begegnungen mit den Niederlanden, 23.10. – 5.11.1985

-
Ausstellung: Ulay und Marina Abramovic – Modus Vivendi, 22.10. – 17.11.1985

-
Ausstellung: VideoOttantaCinque, 13. – 20.9.1985

-
Einzelausstellung: Peter Fischli und David Weiss, 23.8. – 6.10.1985

-
Einzelausstellung: O. M. Ungers, 21.6. – 28.7.1985

-
Ausstellung: Raum – Zeit – Stille, 23.3. – 2.6.1985

-
Ausstellung: Manfred Boecker/Wolfgang Niedecken, 21.2. – 3.3.1985

-
Einzelausstellung: Stefan Wewerka, 18.1. – 10.2.1985

-
Ausstellung: ars viva 84/85 – Farbige Plastik, 14.11.1984 – 6.1.1985

-
Einzelausstellung: Christopher Newman – 1984, 22. – 30.9.1984

-
Ausstellung: Tony Cragg und Julian Opie, 16.9. – 28.10.1984

-
Ausstellung: Kunstlandschaft Bundesrepublik. Szene München/Bayern, 3.6. – 5.8.1984

-
Ausstellung: Die Deutsche Werkbundausstellung Cöln 1914, 24.3. – 13.5.1984

-
Einzelausstellung: Alice Aycock – Zeichnungen und Skulptur-Enviroment, 29.1. – 26.2.1984

-
Einzelausstellung: Robert Wilson – Zeichnungen und Skulpturen, 13. – 22.1.1984

-
Einzelausstellung: John Hilliard – Retrospektive, 20.11.1983 – 8.1.1984

-
Ausstellung: Eine Kunst-Geschichte in Turin 1965-1983, 9.10. – 13.11.1983

-
Ausstellung: Szene Schweiz – Cahn, Lüthi, Spoerri, Walker, 2.9. – 2.10.1983

-
Ausstellung: Peter Skubic und Studenten der Kölner Werkschule, 3.7. – 7.8.1983

-
Ausstellung: Kunst mit Photographie 1960-1980, 3.7. – 7.8.1983

-
Ausstellung: Klangwohnung – Hingstmartin und Theodor Ross, 19. – 24.6.1983

-
Ausstellung: John Cage – A Portrait Series – gesprochen, gespielt, gesungen – radiert, fotografiert, geschrieben, 15.5. – 12.6.1983

-
Ausstellung: Kölner Künstler für die Artothek, 11.5. – 12.6.1983

-
Ausstellung: Acht in Köln, 20.2. – 24.4.1983

-
Ausstellung: Junge Kunst in Deutschland – privat gefördert, 12.11.1982 – 9.1.1983

-
Ausstellung: ars viva 82/83 – Videokunst in Deutschland 1963-1982. Videobänder, Installationen, Objekte, Performances, 6.6. – 18.7.1982

Veranstaltet von
6.6.-18.07.1982 Kölnischer Kunstverein, Köln
5.8.-5.9.1982 Kunsthalle Hamburg, Hamburg
8.9.-17.10.1982 Badischer Kunstverein, Karlsruhe
8.10.-24.10.1982 Westfälischer Kunstverein, Münster
27.10.-28.11.1982 Städtische Galerie im Lenbachhaus, München
10.12.1982-16.1.1983 Kunsthalle Nürnberg/Norishalle, Nürnberg
Ende Januar-Anfang März 1983 Nationalgalerie Berlin, Staatl. Museen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin -
Ausstellung: 5x Fotografie in Deutschland. 1850 bis heute, 23.4. – 23.5.1982

-
Ausstellung: Eine andere Malerei, 4. – 21.3.1982

-
Ausstellung: Isa Genzken, Wolfgang Nestler, Horst Schuler, 28.1. – 14.2.1982

-
Einzelausstellung: Panamarenko – Atom and Manpower, 16.7. – 7.9.1975

-
Einzelausstellung: Mauricio Kagel – Theatrum Instrumentorum, 4.6. – 6.7.1975

-
Ausstellung: Vom Dadamax zum Grüngürtel – Köln in den 20er Jahren, 15.3. – 11.5.1975

-
Einzelausstellung: Laszlo Moholy-Nagy – Retrospektive, 13.1. – 23.2.1975

-
Ausstellung: Radical Software Video-Zeitschrift, 13.1. – 23.2.1975

-
Einzelausstellung: Otto Piene – Retrospektive, 1.12.1973 – 27.1.1974

-
Einzelausstellung: Michael Buthe – Le Dieux de Babylon, 24.8. – 24.9.1973

-
Einzelausstellung: Attila Kovacs – Synthetische Programme, 15.8. – 24.9.1973

-
Einzelausstellung: Duane Michals – Fotosequenzen, 14.7. – 5.8.1973

-
Einzelausstellung: Ulrich Erben, 7.6. – 5.8.1973

-
Einzelausstellung: Robin Page – Auf meinem eigenen Kopf stehend, 2. – 4.3.1973

-
Ausstellung: Gau-Ausstellung Köln 1942 (Malerei, Plastik), 1.9. – 30.11.1942

-
Ausstellung: Kölner Zeichner (Malerei, Grafik), 1.7. – 30.8.1942

-
Ausstellung: Japanische Maler der Gegenwart: Zeichenkunst altjapanischen Stils, 1. – 30.5.1942

-
Ausstellung: Der Deutsche Westen (Malerei, Plastik, Textilgestaltung), 1.2. – 30.3.1942

-
Ausstellung: Japanische Malerei, 1. – 30.12.1934

-
Ausstellung: Müchener Sezession, 1.9. – 30.10.1934

-
Einzelausstellung: Elsa Schulz, 1.6. – 30.7.1934

-
Einzelausstellung: Hermann Dick (Köln), 1.6. – 30.7.1934

-
Ausstellung: Neuere Deutsche Kunst, 1. – 30.5.1934

-
Ausstellung: Werner Scholz, F. M. Jansen, A. Dräger-Mühlenpfordt, E. Gabler, J. Jaekel, 1. – 30.3.1934

-
Einzelausstellung: Wilhelm Lehmbruck, 1.10. – 30.11.1925

-
Ausstellung: Bilder des Impressionismus und Expressionismus aus Kölner Privatbesitz, 1.5. – 30.6.1925

-
Einzelausstellung: Marc Chagall, 1. – 30.4.1925

-
Ausstellung: Wiener Malerei, 1.1925 – 30.4.1926

-
Ausstellung: Sammelausstellung, 1. – 30.1.1925

-
Ausstellung: Alte Malerei aus Kölnischem Privatbesitz, 1.11. – 31.12.1922

-
Ausstellung: Buchschmuck, 1. – 30.9.1922

-
Ausstellung: Neue christliche Kunst, 1.5. – 30.6.1922

-
Ausstellung: Hundert Jahre deutsche Malerei – Nazarener und Romantiker, Bürgerliche Kleinmeister, Ruhe und Bewegung, 1. – 30.3.1922

-
Ausstellung: Winterausstellung im KKV, 1.12. – 28.2.1915

-
Ausstellung: Schwarz-Weiß-Ausstellung, Überblick über die neuzeitige deutsche Grafik, 1. – 30.8.1915

-
Ausstellung: Simplizissimus-Zeichner, 1. – 30.4.1915

-
Ausstellung: M. Liebermann, W. Trübner, E. R. Weiß, U. Hübner, Ernst Barlach, A. Gaul, u.a., 1. – 30.3.1915

-
Einzelausstellung: Ludwig von Hofmann, 1. – 30.9.1914

-
Einzelausstellung: Van Gogh, 1. – 30.7.1914

-
Einzelausstellung: Adolph Menzel, 1. – 30.6.1914

-
Ausstellung: Vereinigung Kölner Künstler, 1.6. – 30.7.1914

-
Einzelausstellung: W. Schreiner, 1. – 30.6.1914

-
Ausstellung: Kardorff, Weinsheimer, W. Schreuer, Bretz, Pascin, Westenburger, Barlach, Lehmbruck, Sperl, Pille, 1.5. – 30.6.1914

-
Ausstellung: Belgische Künstlervereinigung „L´Art Contemporain“, 1. – 30.4.1914

-
Einzelausstellung: August Deusser, 1. – 30.3.1914

-
Ausstellung: Rheinische Künstlervereinigung mit C. Sohn, E. Heckel, H. Dornbach, W. Heuser, J. Greferath, E. Isselmann, F. M. Jansen, 1. – 30.1.1914

-
Einzelausstellung: Fritz Westendorp, 1. – 30.1.1914

-
Ausstellung: Liebermann, Kalckreuth, 1. – 31.12.1913

-
Einzelausstellung: Eröffnungsausstellung Gemäldegalerie des Kölnischen Kunstvereins, 1.9. – 30.11.1913

-
Ausstellung: J. Zon (Haag), Erich von Perfall, Rirkens, Simplizissimus-Künstler, 1. – 30.5.1913

-
Einzelausstellung: Max Stern, 1. – 30.5.1913

-
Ausstellung: Corinth, Slevogt, Liebermann, Trübner, Lucas, Georgi, 1. – 30.3.1913

-
Ausstellung: Benno Elkan, Bayer, Oawald, Schuch, 1. – 28.2.1913

-
Ausstellung: Jahresausstellung der „Kölner Sezession“, 1. – 30.1.1913

-
Ausstellung: Wiener Sezession, 1. – 31.12.1912

-
Ausstellung: Arbeiten des graphischen Wettbewerbs für eine Jahresgabe, 1. – 31.12.1912

-
Ausstellung: Kunst des 19. Jahrhunderts in Kölner Privatbesitz, 1.10. – 30.11.1912

-
Ausstellung: Künstlerverbindung Niederrhein, 1. – 30.9.1912

-
Ausstellung: Rippl-Ronai, E. Isselmann-Rees, A. Faure, Otto Hetchert, 1. – 30.8.1912

-
Ausstellung: Schweizer Künstler mit Meyer, W. L. Lehmann, H. B. Wieland, Pellegrini, 1. – 30.8.1912

-
Ausstellung: Kunst des 19. Jahrhunderts, 1. – 30.7.1912

-
Ausstellung: Werke zeitgenössischer deutscher Porträtisten, 1. – 30.6.1912

-
Ausstellung: Jansen, Modersohn, Hestair, Tarkoff, Melzer, Lichtenberg, 1. – 30.5.1912

-
Ausstellung: Berliner Impressionisten, 1. – 30.4.1912

-
Ausstellung: Von Hofmann, Gauguin, Zöringer, Bizer, Treumann, Faßbinder u.a., 1. – 30.3.1912

-
Ausstellung: Düsseldorfer Malerschule, 1. – 31.12.1911

-
Ausstellung: Kunst unserer Zeit, 1. – 30.10.1911

-
Ausstellung: Oppenheimer, 1. – 30.8.1911

-
Einzelausstellung: Wilhelm Leibl, 1. – 30.7.1911

-
Einzelausstellung: Ferdinand Hodler, 1. – 30.6.1911

-
Ausstellung: Pötzelsberger, Schickard, Ersers, Guillery u.a., 1. – 30.5.1911

-
Ausstellung: Erler, Lasch, Schleicher, 1. – 14.2.1911

-
Ausstellung: Hoetger, Bölker, Everbeck (Worpswede), Nolde, Wilhelm Pütz, 1. – 30.1.1911

-
Ausstellung: Zweite Ausstellung des Kölner Künstlerbundes, 1. – 30.11.1910

-
Ausstellung: Ausstellung von Sammlungen, 1. – 30.10.1910

-
Ausstellung: Gemälde für den Kreuzer „Köln“, 1. – 30.9.1910

-
Ausstellung: Sonderausstellung der Düsseldorfer Künstlergruppe „Niederrhein“ (Malerei), 1. – 30.9.1910

-
Ausstellung: Grafische Kollektion deutscher, französischer und englischer Künstler, 1. – 30.7.1910

-
Ausstellung: Henning, Ritzenhofen, Quedenfeld, 1. – 30.7.1910

-
Ausstellung: Dupont, Drendorff, Stern, Bartning, Stüttgen, 1. – 30.5.1910

-
Ausstellung: Wilhelm Busch-Nachlass, Voigts (München), König (Köln), 1. – 30.4.1910

-
Ausstellung: Oßwald, Helberg, Jokisch, Türoff, Grüter, 1. – 28.2.1910

-
Einzelausstellung: Hans von Marees, 1.2. – 30.3.1910

-
Ausstellung: Düsseldorfer Künstler, „Vereinigung von 1899“, 1. – 30.1.1910

-
Einzelausstellung: E. Oppler, 1. – 30.1.1910